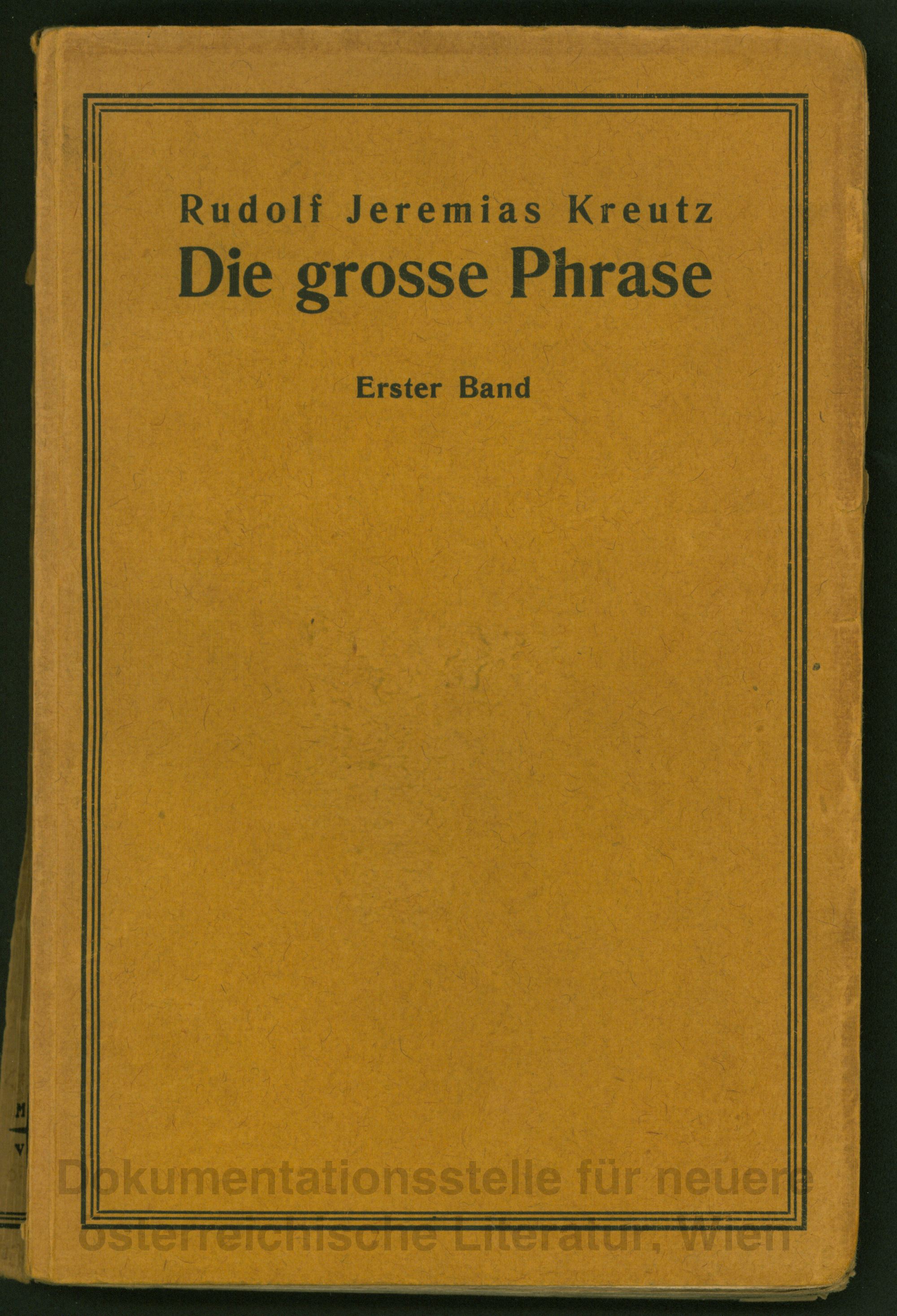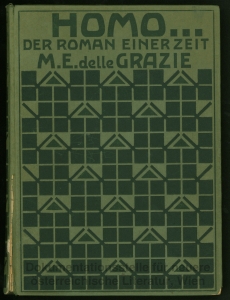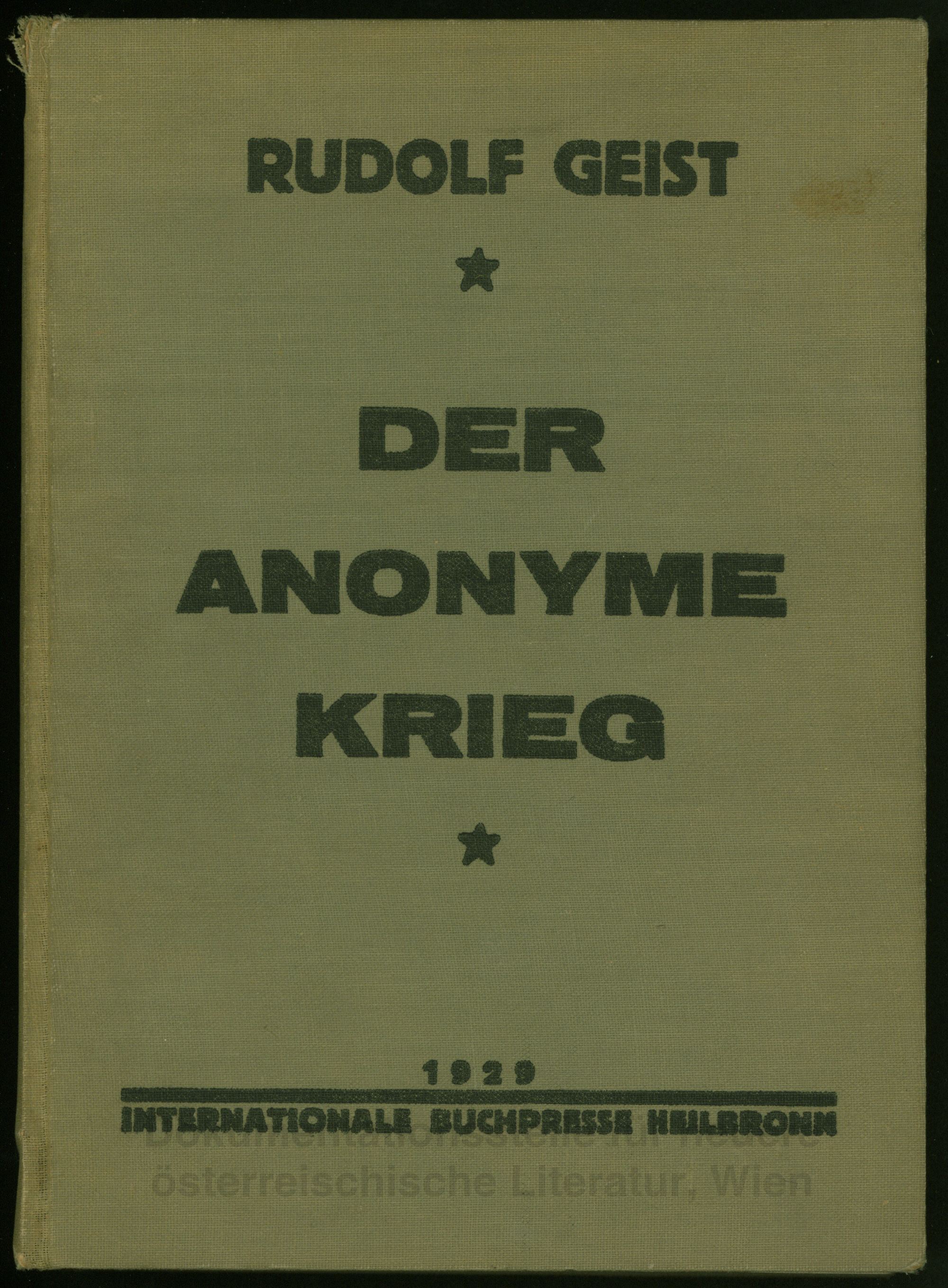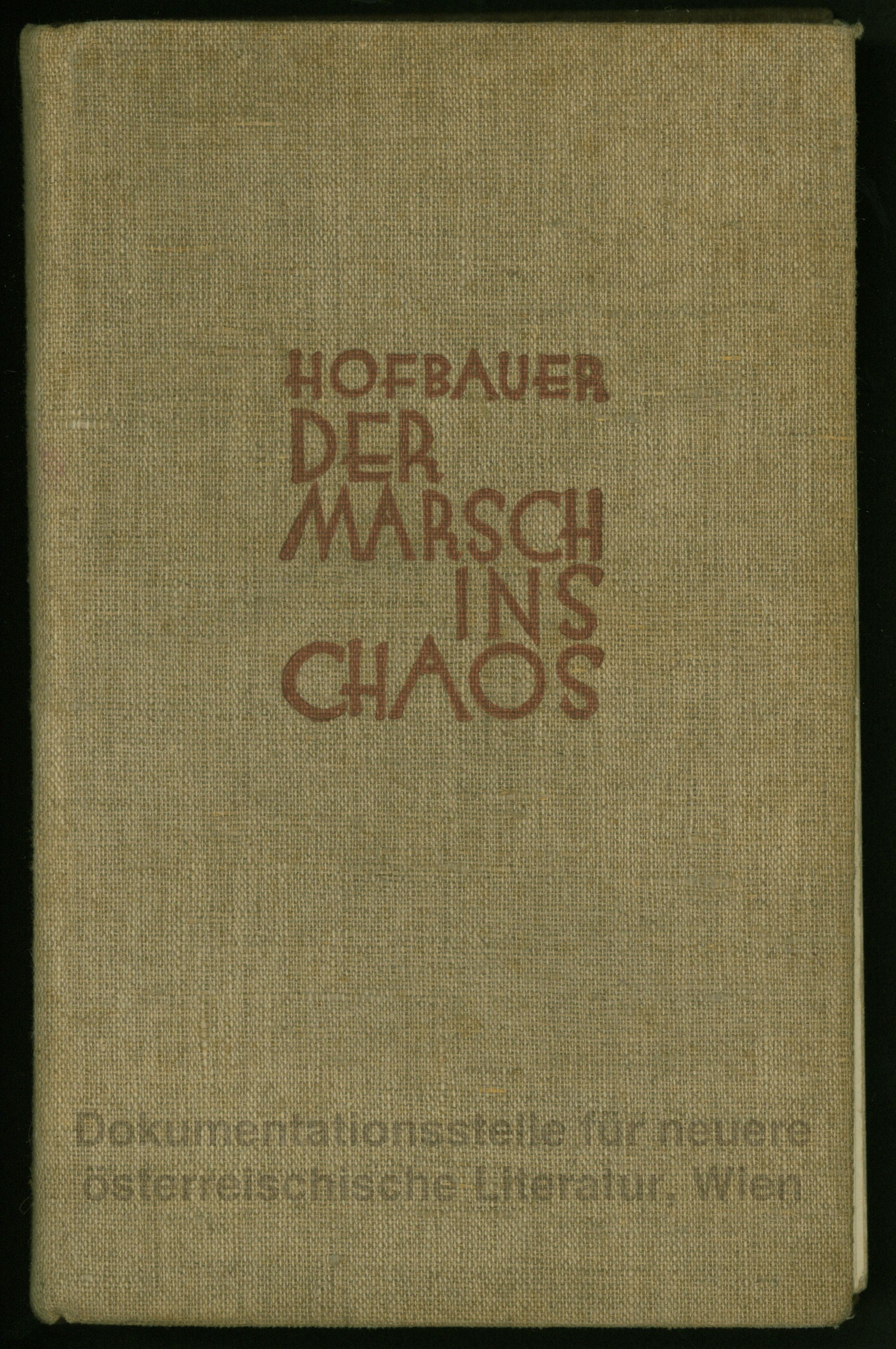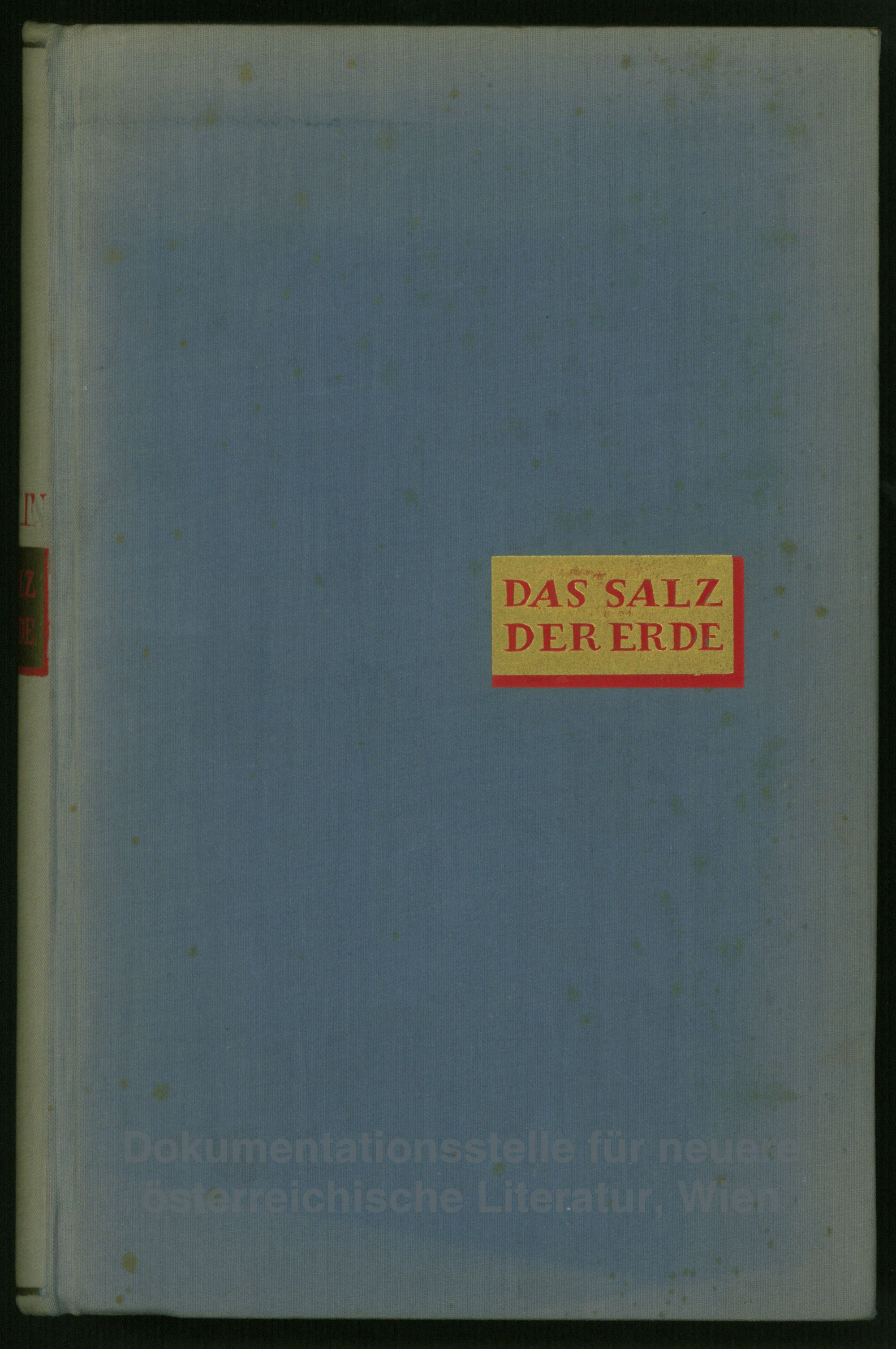Der österreichische Antikriegsroman 1917-1935
Die österreichische Antikriegsliteratur steht zweifellos im Schatten von Karl Kraus‘ monumentaler seit 1915 entstandener, 1922 veröffentlichter Tragödie Die letzten Tage der Menschheit, aber auch in jenem der Ende der 1920er Jahre veröffentlichten Kriegsromane der Weimarer Republik (Remarque, Renn, A. Zweig). Das vorliegende Modul widmet sich einerseits Texten, die bereits ab 1917/18 eine kritische Darstellung der Kriegserfahrung vorlegten, wie z.B. Romanen von R. J. Kreutz oder M. Eugenie delle Grazie, andererseits einer Reihe von parallel zu Remarque, Renn u.a. erschienenen Erzählungen und Romanen, die aus verschiedensten Blickwinkeln Facetten der Zeitstimmung um 1914 (M. Brod, J. Wittlin ), der baldigen Desillusionierung (H. Broch, F. Werfel, J. Hofbauer), der Traumatisierung (R. Geist, J. Roth, L. Perutz), aber auch der Verdrängung (H.v. Hofmannsthal) in den Blick nehmen und gestalten.
Von Evelyne Polt-Heinzl | Jänner 2016
Inhaltsverzeichnis
- Über den Krieg schreiben
- Der große Zivilisationsbruch
- Als der Krieg zu Ende war
- Der andere Kriegsroman
- Der vergessene österreichische Remarque: Rudolf Geist
- Die Gewalt der Kriegsmaschinerie
- Der Krieg lebt weiter
- Wie aber hat es dazu kommen können?
(1) Über den Krieg schreiben
Die Lyrikproduktion zur Verherrlichung des Krieges setzte bereits im August 1914 massiv ein und auch sonst fehlte es nicht an kämpferischen Adressen. Selbst Robert Musilgeb. am 6.11.1880 in Klagenfurt – gest. am 15.4.1942 in Genf; Schriftsteller, Essayist, Wissenschaftler, Theaterkritik... publizierte im September 1914 seinen Essay Europäertum, Krieg, Deutschtum in der Neuen Rundschau, in dem er verkündete:
Der Tod hat keine Schrecken mehr, die Lebensziele keine Lockung. Die, welche sterben müssen oder ihren Besitz opfern, haben das Leben und sind reich: das ist heute keine Übertreibung, sondern ein Erlebnis, unüberblickbar aber so fest zu fühlen wie ein Ding, eine Urmacht.1
Im darauffolgenden Heft der Neuen Rundschau war dann freilich schon Stefan Großmanns Erzählung Der Vorleser der Kaiserin zu lesen. „Jetzt ist keine Zeit für Pindar und Plato. Diese schönen Träumereien wären jetzt sündhaft, es wäre Luxus“ (VLK, 119). Mit diesen Worten entlässt hier die schöngeistige Kaiserin ihren Vorleser, Professor Laurenz Maier, der wenig später den Freitod wählt. „Ich will nicht leben in einer Welt, wo das Töten wichtiger ist als das Denken“ (VLK, 122), schreibt er in seinem Abschiedsbrief. In der Buchausgabe 1925 fügte Großmann den Hinweis an: „Geschrieben im Oktober 1914“ (ebd.).
„Unsere Dichter und Schriftsteller waren dem Massenerlebnis des Krieges nicht gewachsen“, sagt in Franz Werfels Roman Barbara oder Die Frömmigkeit der Unternehmer Aschermann, „weder im Aufschwung noch im Leid … Kein Lied ist entstanden, kein Epos, das der Zeit würdig wäre … Eine armselige Heerfahrt mit Speer und Schild, Pfeil und Bogen hat das Nibelungenlied gezeitigt … Und der größte aller Kriege hat, soweit ich es übersehen kann, nichts hervorgebracht.“ (BF, 421)
Aschermann, ein Porträt des Kriegslieferanten Josef Kranz, der 1917 wegen Preistreiberei verurteilt wurde, vermisst im Rückblick den großen Heldenroman des Krieges. Das tat auch der Presseclub ConcordiaIn Vorbereitung/ in preparation und initiierte im Juli 1917 ein entsprechendes Preisausschreiben.
Doch 1917 erschien mit Rudolf Jeremias Kreutz‘ Die große Phrase bereits der erste österreichische Antikriegsroman – aus Zensurgründen zunächst auf dänisch, 1918 auf schwedisch, 1919 folgten eine englische Übersetzung. Kreutz war als Berufssoldat der Kriegsbegeisterung 1914 keineswegs entgangen, aber als Praktiker im militärischen Feld setzte die Ernüchterung über die Unfähigkeit und Skrupellosigkeit der militärischen Führer rasch ein. Noch in russischer Gefangenschaft, schrieb er seinen Roman über diesen Prozess der Neupositionierung am Beispiel des Oberleutnants Hans Zillner. Darin spießt Kreutz bereits vieles auf, was Karl Kraus dann in Die letzten Tage der Menschheit verarbeitet, von den Propagandalügen bis zur Verrohung an der Front wie im Hinterland, von den Postkarten mit Kriegskrüppeln bis zu allen möglichen Varianten der Phrase von der großen Zeit.
Auch die Sprache ändert sich im Verlauf des Romans. Sind die Dialoge zunächst noch reichlich derb, weitet sich mit Zillners Blick gleichsam auch der Wortschatz. Zunehmend fassungslos sieht er die sinnlose Brutalität und die Demoralisierung der Truppen, die systematisch verheizt werden von Feldherrn, die zu ihrem Amt „ausser der Protektion nichts von Belang“ mitbrachten. Wenn nichts mehr geht, fällt ihnen das „herrliche Schlagwort ,Niederrennen‘ ein, die hilfreiche Wortkrücke für hilflos tappende Feldherrngehirne“ (GPH, Bd 1, 111). Die Generäle, so der Vorwurf, haben zwar keine Strategie, spekulieren aber auf einen raschen Orden und opfern dafür ihre Truppen in sinnlosen Metzeleien. „Unglaublich … Mit kaum dreissig Prozent Verlusten geht der Mensch zurück und behauptet noch, die Stellung sei unhaltbar“ (GPH, Bd 2, 31), empört sich einer der Herren am Kartentisch in der Etappe. Damit destruiert Kreutz den Mythos von der egalisierenden Wirkung der Fronterlebnisse – blieb der Nachschub aus, blieb er nur für die Truppe aus, während die Chargen im Bedarfsfall ihre Quartiere weiter zurück verlegten. Auch die Verlogenheit der Kriegsberichterstattung thematisiert der Roman, und zwar nicht aus der Perspektive des Hinterlands, sondern vom anderen Ende her, wenn die offizielle Meldung des Generalstabs gegen die Evidenz des eigenen Erlebens der Soldaten verkündet: „Die Lage […] ist auch heute unverändert“ (ebd., 108).
Die deutsche Erstausgabe des Romans erschien 1919 im Züricher Verlag Max Rascher, im selben Jahr wie die Aktausgabe von Karl Kraus‘ Die letzten Tage der Menschheit, das Buch folgte 1922. Respekt verschaffte ihm das bei Kraus nicht. Kreutz war als Verfasser von Militärhumoresken für Kraus schon vor 1914 ein beliebtes Angriffsziel. Daran änderte Kreutz‘ Antikriegsroman nichts, der immerhin noch zu einer Zeit erschienen war, als es „lebensgefährlich war, gegen den Weltirrsinn Protest anzusagen“2. Das schrieb Kraus 1931 über Andreas Latzkos 1917 ebenfalls im Verlag Max Rascher, allerdings anonym, erschienenen Erzählband Menschen im Krieg – ohne diesen Mut auch Kreutz gutzuschreiben. Dass unter den sieben Kandidaten für den Strindberg-Preis 1921, ausgeschrieben für ein Werk über den ,Großen Krieg‘ im Sinne der Völkerversöhnung, Kreutz aufschien, er selbst aber nicht, hat Kraus zu einer entsprechenden Eingabe veranlasst. Der zuständige Juror und Strindberg-Übersetzer Emil Schering erklärte, dass nur Bücher, nicht Zeitschriften für den Preis nominiert wurden, was die Unkenntnis der Letzten Tage der Menschheit eingesteht und Kraus noch weiter erboste3.
Andreas Latzko veröffentlichte 1918 bei Rascher auch den Band Friedensgericht. Der Titel bezieht sich auf den kurzen letzten der sechs lose gefügten Abschnitte. Er spielt im Irrenhaus, wo die vom Krieg psychisch Zerstörten landeten. Einer von ihnen will ein Friedensgericht gegen seinen verhassten Vorgesetzten von einst einberufen, doch die Salutschüsse haben noch nicht den Frieden eingeleitet, sondern irgendeinen kleine Frontsieg verkündet.
Zentralfigur der sechs Episoden ist der 33-jährige Pianist Georg Gadsky, der sich – wie sein Autor – 1914 freiwillig an die Front meldet, nicht weil er dem kollektiven Jubel der Mobilmachung erlegen wäre, sondern um seiner adeligen Geliebten zu imponieren. Er bereut seine Entscheidung schon während der Grundausbildung bitter, denn die Demütigungen des groben Feldwebels Stuff kann Gadsky, der vom Eisenbahnersohn zum gefeierten Pianisten aufgestiegen ist, ganz besonders schlecht vertragen. Das Gefühl, besser und mehr zu sein als seine Kameraden, ist der beherrschende Impuls in allen Momenten der Handlung. Als intellektueller Schöngeist fühlt er sich jedenfalls all den dumpfen Gesichtern, die ihn hier umgeben, turmhoch überlegen. Keinen Gedanken verschwendet er an „ein naheliegendes Motiv, dessen Wichtigkeit nicht genug eingeschätzt wird. Der Weltkrieg war für Tausende von Menschen eine Erlösung vom Hunger. Leset die Statistiken des Elends nach“ (BF 175).
Die überlangen Passagen sind, in denen Gadsky mit einigen Freunden wie dem Dichter Weilen über Krieg und Frieden und das Oben und Unten in der Gesellschaft – hier ist Gadsky unbelehrbar – streitet, sind ermüdend und unbeholfen holprig. Am besten gelungen ist der dritte Abschnitt mit dem Titel „Nachschub“, der an die Front führt. Freilich kann Gadsky selbst hier seinen Dünkel gegen die „seelenlose Herde“ (FG 67) seiner Kameraden nicht lassen und sieht den Krieg vor allem als persönliche Ungerechtigkeit, aber die Beschreibung der unterschiedlich ausgelebten Todesangst und das Grauen der sinnlosen Schlacht sind beeindruckend beschrieben.
Insofern ist Friedensgericht wohl ein Antikriegsroman, auch wenn die Hauptfigur, anders als bei Kreutzer, nicht wirklich als Kriegsgegner gelten kann. Die deutlich der Argumentation Bertha von Stuttner folgenden Stellungnahmen gegen den Krieg werden meist Gadskys Gegenüber in den Mund gelegt. Für ihn bleibt soziale Anerkennung seiner Person der zentrale Punkt. Wo immer er sie vorübergehend erhält, und sei es von einem Major im französischen Rekonvaleszentenheim, fühlt er sich durchaus wohl.
Latzko verfasste 1918 auch etwas eigenartig anmutende „Geleitworte“ zur zweiten Internationalen Frauenkonferenz für Völkerverständigung in Bern 1918, in denen er die Verrohung der Frauen durch ihre Kriegsbegeisterung anprangert. Das größte Übel für den „Heimkehrenden, Schwergeprüften“ sei „ein Weib, das er nicht wiedererkennt“ (FK 6), weil es nicht mehr dem über „[a]nderthalb Jahrtausende“ gemodelten Bild der „christlichen Frau“ (FK 7) entspricht. „Denkt doch nach, Ihr Frauen!“ ruft er den versammelten weiblichen Delegierten zu, „lautete je, ehe dieser Krieg begonnen, die Parole für euch, es den Männern gleich zu tun? Ob von Wahlrecht oder Wählbarkeit, von der Zulassung zur Universität oder zu männlichen Berufen die Rede ging, – von oben her, von den Rechtgläubigen, von dort, woher jetzt die Heldenmütter gefordert und gefördert werden, kam immer nur die Ermahnung, weiblich zu sein, weiblich zu bleiben. Und jetzt auf einmal, weil es Krieg gibt, sollen männliche Tugenden dem Weibe zum Schmucke gereichen?“ (FK 10)
(2) Der große Zivilisationsbruch
Unauslöschlich ist der Krieg in den Köpfen der Menschen, ihre Gedanken „sind unterhöhlt vom Militarismus, der Sucht, zu zerstören“ (NF, 20), schrieb Arthur Holitscher 1925. Er war von der Unmöglichkeit eines nahtlosen Anknüpfens an zivilisatorische Vorkriegsstandards überzeugt. Einkaufen zum Beispiel sei nicht mehr ‚unschuldig‘ möglich. Es sei „keine Freude mehr an dem Auswählen, Mitnehmen, Vorgenuß des Aufstellens, Einreihens des schönen Gegenstandes, an der Bereicherung. […] Wie wirkt Lewisite auf Ledereinband, Halbleinen, Pappband? Auf Kaiserlich Japan, Bütten, holzfreies, holzhaltiges Papier? Über seine Wirkung auf animalisches Gewebe, Fleisch, Muskeln, Knochen, bin ich hinlänglich unterrichtet“ (ebd., 52f.). Lewisit ist eine chlorhaltige Arsenverbindung, die Winford Lee Lewis 1918 nach der Erfahrung mit Giftgas im Ersten Weltkrieg als Option für künftige militärische Einsätze erfand.
Auch das Tourismusangebot „Reise zu den Schlachtfeldern“ (NF, 58) – als „Reklamefahrten zur Hölle” fixer und in der überlieferten Phonogrammaufzeichnung unerträglich pathetisch vorgetragener Bestandteil von Karl Kraus’ Leseprogrammen – nimmt Holitscher aufs Korn. Die subtilste Auseinandersetzung mit der touristischen Vermarktung der Schlachtfelder stammt allerdings von Stefan Zweiggeb. am 28.11.1881 in Wien – gest. am 23.2.1942 in Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien; Schriftsteller, Übersetzer..., der 1928 Ypern in Belgien bereiste, wo 200.000 Soldaten umgekommen und eine Vielzahl von kleinen Städten in Kraterlandschaften aus Schuttwucherungen verwandelt worden waren; ein Jahrzehnt später sind sie wieder aufgebaut, und zwar originalgetreu, nur im Ortskern von Ypern selbst ist die einst berühmte Stadthalle als Ruine erhalten geblieben4. In Ypern aber hatten die deutschen Pioniere am 22. April 1915 erstmals 160 Tonnen Chlorgas eingesetzt und damit den Giftgaskrieg eröffnet.
Giftgas war die Revolution der (Kriegs-)Technik; die Ungeheuerlichkeit seiner Wirkung zu beschreiben, stellte eine sprachliche Herausforderung dar. Rudolf Brunngrabergeb. am 20.9.1901 in Wien – gest. am 5.4.1960 in Wien; Schriftsteller, Maler, Grafiker Ps.: Sverker Brunngraber (... versucht in seinem Roman Karl und das 20. Jahrhundert die Verbindung aufzuzeigen zwischen der Zivilisation, die im Giftgaseinsatz „mit tödlichem Glanz in Erscheinung“ (KA, 161) trat, und dem technischen Fortschritt:
Das leichenweiße, aber eiserne Gesicht des zwanzigsten Jahrhunderts hob sich großartig aus dem Granatendampf. Hinter ihm sprangen die Wasserkraftwerke auf, begannen die Fernleitungen den Erdball mit gefrorenen Blitzen einzuspinnen, hob in den metallurgischen und chemischen Laboratorien eine Walpurgis der Erfolge an. […] Der Dampf verdrängte das Wasser, die Elektrizität den Dampf und das Öl die Kohle, die in dem Krieg, der um sie tobte, überwunden wurde. (KA, 157)
„Mit milchweißen Tatzen kroch der tausendgestaltige Nebel reptilhaft schmiegsam über das Feld, um in Löcher, Riffe, Trichter, Gräben, Gruben tödlich zu schlüpfe“ (BF, 332), heißt es in Werfels Barbara oder Die Frömmigkeit. Die Hauptfigur arbeitet hier als Chef der Telefonstation des Bataillonskommandos. Das ist nicht nur ein autobiographischer Reflex – Werfel war einige Zeit Telefonist hinter der Frontlinie in Galizien –, es entspricht dem kriegsindizierten Technologieschub, der sich zahlenmäßig festmachen lässt. Die Nachrichtentruppe der deutschen Armee etwa war mit 550 Offizieren und 5.800 Mann in den Krieg gezogen und kehrte 1918 mit 4.381 Offizieren und 185.000 Mann zurück5. Nachrichtentechnik und Aviatik waren jene Branchen, die dem Ersten Weltkrieg den größten Technologieschub verdankten.
Einen großen Aufschwung nahm auch die Statistik. Die sachliche Registrierung der Kriegsschäden, Opfer und Materialverluste schärfte den Blick für die quantitative Erfassung von Fakten und wies statistischen Methoden neue Aufgaben zu. Daraus entstand der bemerkenswerteste Arbeitslosenroman der österreichischen Literatur: Rudolf Brunngrabers Karl und das 20. Jahrhundert. Brunngraber setzt jene Wiener BildstatistikDie B. oder Isotypie (engl. für: International System of Typographic Picture Education) wurde ab Mitte der 1920er Jahre... literarisch um, die Gerd Arntz und Otto Neurathgeb. am 10.12.1882 in Wien - gest. am 22.12.1945 in Oxford; Ökonom, Wissenschaftstheoretiker, Sozialpolitiker, Museumsp... entwickelt haben. Neurath hatte als Mitarbeiter der Wirtschaftsabteilung des Kriegsministeriums 1915/16 eine Forschungsstelle angeregt, um die Erfahrungen der Kriegswirtschaft für spätere Nutzung zu dokumentieren6. Nach den Heeresverbänden war das Heer der Arbeitslosen die zweite Bewährungsprobe statistischer Methoden im Dienste technokratischer Verwaltung von Massenphänomenen.
Von der statistischen Ordnung der Zeitprobleme erwarteten sich die Zeitgenossen viel. Darüber macht sich Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften lustig mit der Jubiläumsidee, den statistischen Mittelwert der Balkenzahl aller im öffentlichen Raum lesbaren Schriftzeichen zu erhöhen, denn die Buchstaben mit vier Balken seien ein Glücksversprechen, WEM also ein Glücksfall, wohingegen es die einbalkigen Buchstaben O, S, I, C zu unterdrücken gelte. Musils Ulrich hingegen schlägt ein „Erdensekretariat der Genauigkeit und Seele“ vor, denn es gehe darum, „den Anfang einer geistigen Generalinventur zu bilden! Wir müssen ungefähr das tun, was notwendig wäre, wenn ins Jahr 1918 der Jüngste Tag fiele, der alte Geist abgeschlossen werden und ein höherer beginnen sollte.“ (MOE, 597)
(3) Als der Krieg zu Ende war
1918 schien mit dem Zusammenbruch der Monarchie der alte Geist tatsächlich radikal abgeschlossen und das ,Höhere‘ der Kriegseuphorie final desavouiert. Die Abwicklung der Monarchie und die Demobilisierung der Kriegsmaschinerie wurde zur materialen Basis vieler Schieberkarrieren, deren ökonomisches Deregulierungspotential nahtlos auf die Inflationsspekulanten überging. Das stellte andere Themen und Probleme in den Mittelpunkt und verhinderte eine Beschäftigung mit dem Krieg über längere Zeit.
Trotzdem erschien bereits 1919 der zweite österreichische Antikriegsroman Homo … Der Roman einer Zeit von Marie Eugenie delle Grazie. Sie begann als Lyrikerin, engagierte sich in der Arbeiterbildung und schrieb mit dem Bergarbeiterdrama Schlagende Wetter, 1900 am Volkstheater in Wien uraufgeführt, das einzige naturalistische Drama der österreichischen Literatur. 1912 vollzog sie eine radikale Wende hin zum Katholizismus, womit sie alle ihre bisherigen Publikationsorte verlor und kaum mehr wahrgenommen wurde. 1919 aber, als Homo erschien, ließ der Verlag Waldheim-Eberle vom ehemaligen Kriegszeichner und späteren Graphiker des Ullstein-Imperiums Theo Matejko ein Werbeplakat (Abb. Plakat, ÖNB) anfertigen, das mit grellen Farben die Schrecken des Krieges ins Bild bannt, die der Roman beschreibt. Er setzt mit einem langen Kapitel an der Front ein und thematisiert die Flüchtlingsströme aus den umkämpften Kronländern ebenso wie die Auswirkungen des Kriegs im Hinterland.
Zu Beginn wartet Hauptmann Hans Willander, im Zivilberuf Universitätsgelehrter, mit seiner Truppe in seiner Stellung am Duklapass, der wie alle Karpatenpässe zu Beginn des Ersten – und Zweiten – Weltkriegs hart umkämpft war. „Fünf Schritte nach rechts – acht Schritte nach links“ (HO, 4), das ist Willanders Aktionsradius im Unterstand, und das ist ihm Symbol, wie sich im Zeichen der allgemeinen Kriegseuphorie die Lebens- und Denkwege der Menschen verengen.
Wie lange war es her, seit die Menschen sich solche Höhlen in die Erde gegraben, wie lange nur? […] Wer ist nun wahnsinnig? Er […] oder diese Vielen, die noch keinen Krieg erlebt haben und den Krieg doch plötzlich als eine solche Notwendigkeit erkennen und empfinden, daß sie bereit sind, alles, aber auch alles, was sie haben, hinzugeben? (HO, 30f.)
Er ist kein Kriegseuphoriker und versucht vergeblich, sich von der Notwendigkeit des Geschehens zu überzeugen. „Wer ist nun wahnsinnig?“ fragt er sich, er, der Krieg für eine Ungeheuerlichkeit hält, oder „diese Vielen“, die ihn „plötzlich als eine solche Notwendigkeit erkennen und empfinden, daß sie bereit sind, alles, aber auch alles, was sie haben, hinzugeben?“ (HO, 31) Was ist dieses „Geheimnis […]! Der seltsame ,Mannsrausch‘ […]. Dessen sie alle sich bewußt waren, ohne mit einem Gedanken, einem Widerstand daran zu rühren. Ein ganzes Volk.“ (HO, 32) Willander verschließt sich der Option eines emotionalen Aufgehens im größeren Ganzen der Kriegsmaschinerie, das für viele und aus unterschiedlichen Gründen eine Entlastung bedeutete. Am unteren Ende der sozialen Skala eröffnet der Krieg eine momentane Alternative zu Perspektivlosigkeit, Zukunftsungewissheit und sozialer Not, den Intellektuellen ermöglicht er ein Heraustreten aus einer schmerzlich empfundenen gesellschaftlichen Isolation. Brunngrabers Arbeitsloser Karl fühlt bei Kriegsausbruch „wie rundum plötzlich alle Probleme von gestern leicht wogen“, der „Offiziersrang hatte ihn vom Druck der proletarischen Kindheit befreit“, das „Kommando war an die Dinge übergegangen“ (KA, 32).
In langen Passagen beschreibt delle Grazies Roman die Alpträume der Soldaten, in denen die Gräuel der Fronterlebnisse herumspuken, aber auch die Ängste und Befürchtungen über die zurückgelassenen Frauen, die sie moralisch fast alle scheitern lässt. Sie schildert die Flüchtlingsströme aus den umkämpften Kronländern ebenso wie die Auswirkungen des Kriegs im Hinterland. Homo aber ist der Name eines Waisenkindes, das aus einer eroberten Festung zu Willanders Truppe stößt. Scheint der Junge zunächst stumm, stellt er allmählich die entscheidenden Fragen, die Willander nicht beantworten kann: „Warum schlagen die Menschen einander tot?“ Was sind diese „großen Dinge“, für die sie das tun? Und: „Wer gibt ihnen das Leben wieder?“ (HO, 415)
(4) Der andere Kriegsroman
„Es ist verboten, der Öffentlichkeit Kieferbeschädigungen bzw. deren Gipsabgüsse […] zu zeigen“7, bedauerte Joseph Roth unter dem Titel Die Fratze der Großen Zeit am 31. August 1920 in der Neuen Berliner Zeitung, wäre doch gerade die Sichtbarmachung von Kriegsfolgen dieser Art zur Prophylaxe gegen neue Kriegsgelüste durchaus geeignet. Ein Mann wie Dr. Ottenschlag in Vicki Baums 1929 erschienenem Roman Menschen im Hotel, der sein zerschossenes Gesicht wie ein Mahnmal durch die Nachkriegsgesellschaft trägt, hat nicht nur kein Verständnis für Lebensfreude oder Lebensgier in den Hotelbars, er stört auch das allgemeine Bedürfnis nach Unbeschwertheit und Vergessen. Deshalb wurden Gesichtsentstellte in abgelegenen Lazaretten weggesperrt. „Die Fratze der Großen Zeit“ erzählerisch zu bearbeiten, dauerte eine geraume Zeit.
Der Krieg war nach einer kurzen expressionistischen Predigt aus dem Gesichtskreis des deutschen Geistes verwiesen worden. Die einen wollten ihn nicht wahr haben. Die anderen schämten sich seiner Niederlage. Die dritten wollten schweigen, vergessen. Man richtete sich auf ,Frieden‘ ein.8
So eröffnet Oskar Maurus Fontanageb. am 13.4.1889 in Wien – gest. am 4.5.1969 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, Journalist, Herausgeber Das Port... sein Nachwort zur Neuauflage von Stefan Zweigs Erzählung Der Zwang im Jahr 1929, in dem er kein einziges Werk der österreichischen Literatur erwähnt – auch nicht die beiden frühen Antikriegsromane von Kreutz und delle Grazie und auch nicht Stefan Zweigs pazifistisches Drama Jeremias.
Selbst auf Zweigs Erzählung geht Fontana nicht ein, was durchaus verständlich ist. Denn eine Antikriegserzählung ist Der Zwang nur bedingt. Sie erzählt von einem im sicheren Schweizer Exil lebenden Maler, der den Gestellungsbefehl auf das Konsulat erhält und sich diesem „Zwang“, nämlich dem martialischen Anruf an seine Männlichkeit, nicht entziehen kann, was seine Frau nicht verstehen will.
Ich will ja nicht […]. Ich will ja nicht. Aber sie wollen. Und sie sind stark, und ich bin schwach. Sie haben ihren Willen seit Tausenden Jahren gehärtet, sie sind organisiert und raffiniert, sie haben sich vorbereitet, und auf uns fällt es wie ein Donner. Sie haben Willen, und ich habe Nerven. Es ist ein ungleicher Kampf.9
So jammert er seiner Gattin vor, die darauf verständlicherweise einigermaßen angewidert reagiert. Erst als er kurz vor dem Grenzübertritt nach Österreich einen Verwundetentransport begegnet, kehrt er doch noch um. Zweigs Text war zuerst 1920 im Insel Verlag erschienen und die Neuauflage 1929 nutzte – wie Zweig das stets verstand – geschickt die Welle der neuartigen Frontromane, die in Deutschland gegen Ende der 1920er Jahre einsetzte.
1927 erschien mit Der Streit um den Sergeanten Grischa der erste Band von Arnold Zweigs Romanzyklus Der große Krieg der weißen Männer, 1928 Ludwig Renns Frontroman Krieg; am 10. November 1928 begann die Berliner Vossische Zeitung mit dem Vorabdruck von Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues. War in den Kriegsbüchern bisher „der Krieg immer etwas ‚Außergewöhnliches’“, wird er nun etwas „ungeheuer Gewöhnliches“, schrieb Joseph Roth über Siegfried Kracauers ebenfalls 1928 anonym publizierten Roman Ginster.
(5) Der vergessene österreichische Remarque: Rudolf Geist
1928 legte auch Rudolf Geist seinen Roman Der anonyme Krieg vor, der das Desaster aller zivilisatorischen Werte mit ungestüm aufgebrochener Syntax und grellen Bildern in Szene setzt. Zentralfigur ist der Wiener Rüstungsindustrielle Wilhelm Cäsar Boß, kurz W.C.B genannt. Das erinnert lautlich nicht zufällig an die für die offizielle Kriegsberichterstattung zuständige Nachrichtenagentur WTB – Wolffs Telegraphisches Büro. Boß verdient prächtig, nicht zuletzt dank der Idee seines Ingenieurs Sulcer, Material sparende Blindbomben darunter zu mischen, um am Kriegsgeschehen zu verdienen und es zugleich im Interesse der Gewinnmargen zu unterlaufen.
„[…] der moralische Umschwung eines Munitionsfabrikanten führt immer zum Patriotismus; doch es liegt in der Natur der Zahlen, daß die patriotische Ueberentwicklung zum Bankkonto führt. Das Vaterlandsgefühl geht über den Patriotismus zur sentimentalen Reue, daß der Krieg so blutig ist und man mittun muß, worauf man sich für ein System energischerer Gefühle entscheidet: für die erkannte traditionelle Brutalität. […] Ich will es Ihnen anders sagen …“ Sulcer schrie die Worte: „Wenn weniger sterben, so verdienen wir mehr! […] das ist unsere Ethik: weil wir mehr verdienen, darum verbluten weniger Menschen.“ (AK, 6)
Skrupellos und geldgierig ist auch der Firmeneigner W. C. Boß, aber er hat auch sentimentale Anwandlungen. Als er aus dem Geschäft aussteigen und die Armee nicht länger mit Blindgängern betrügen will, meint Sulcer nur: „Flausen! Ob wir Akkumulatoren und autogenische Schweißapparate erzeugen oder Gasgranaten und Fliegerbomben, das spielt auf dem Warenmarkt keine Rolle.“ (ebd.) Sulcer ist eine aalglatte, gewissenlose Teufelsfigur, Boß ein cholerischer Borderliner von monströser Körperlichkeit mit Schuhgröße 55, dabei ein sentimentaler Familienmensch. Boß leidet unter dem Hass seines Sohnes Franz, der ihm lange Epistel schreibt, ihn mit wüsten Worten als betrügerischen Kriegsgewinnler beschimpft, und sich schließlich freiwillig zur Sanität meldet.
Franz kommt just an die Isonzo-Front, wo die neuen, hochgiftigen W.C.B.-Bomben – vermutlich Phosgenbomben, auch sie nur zum Teil gefüllt – erstmals eingesetzt werden. Auch Boß reist hin, um ihre Effektivität zu beobachten, bleibt allerdings in der Etappe, wo die Frontbordelle stehen, die Chargen gut essen und viel trinken. Am Vorabend des großen Gemetzels zeigt Geist die Produkte der Kriegsdichter im Praxistest. Gedichte von „Gerhart Hauptmann, Lissauer, Ganghofer, Petzold, Kernstock, Kerr, Dehmel und anderen geistigen Bomben“ werden den Soldaten zur Aufmunterung vorgelesen. Franz wird inmitten des Gemetzels dann wahnsinnig und vor den Augen seines Vaters, der via Fernrohr das Spektakel beobachtet, von einer seiner Bomben zerrissen.
Im Schlusswort nennt Geist sein Buch einen „real-psychologische[n] Ereignis- und Höllenbericht vom Ende des Weltkrieges“ (AK, 417) und fügt eine Hommage an Karl Kraus‘ Die letzten Tage der Menschheit an. Geists Frontberichte sind voller Sarkasmus, George Grosz‘scher Überzeichnung und greller Drastik, die die Einzigartigkeit von Geists Roman ausmachen. Was Kraus bewusst plakativ kompiliert, spitzt Geist mit dem Messer seiner Groteske ins Schmerzhaft-Radikale zu. Und er verschmilzt in der Figur des W. C. Boß Schein und Sein der großen Gewinner im Kriegsgeschäft.
Er litt unter der Angstvorstellung, daß die Kombination der Boß-Sulcer kriegstechnisch vom Feind übertrumpft und eine noch mehr wirksame Gas- und Geschoßkampfmethode in Anwendung kommen könnte. Er sagte sich, sein wissenschaftlicher Stolz habe kein gutes Gewissen: betröge er doch die Armee mit minderem Material und zur Hälfte mit Blindgängern. Da er nicht wissen wollte, daß er Hochverräter und Patriot, Verbrecher am Feind und Verbrecher am Freund – am Leben und am Tode in einer Person war, so schüttelte er die Stimme des Gewissens von sich. (AK 130)
Karl Kraus nahm von Geists Roman zwar Kenntnis, allerdings nur in einer seiner peniblen Auflistungen aller publizistischen Erwähnungen seines Namens10. Am Thema oder an Geist als potentiellem Mitbewerber in diesem Feld war Kraus offenbar nicht (mehr) interessiert. Seine Monopolstellung als Pazifist der ersten Stunde war – und blieb es bis heute – mit dem Erfolg seiner Letzten Tage der Menschheit einzementiert.
(6) Die Gewalt der Kriegsmaschinerie
1930 erschien Josef Hofbauers Frontroman Der Marsch ins chaos. Franz Dorniger, Familienvater, kurzsichtig, vom Beruf Buchhalter und deutscher Turner, wird bei der dritten Nachmusterung einberufen. Die Kriegseuphorie ist da schon vorbei, der Landsturmrekrut Dorniger rückt keineswegs freudig ein, aber Pflicht ist Pflicht. Das beginnt er im Lauf der Zeit dann etwas anders zu sehen. Hofbauer beschreibt die Desillusionierung der einfachen Soldaten über die Realität des Frontgeschehens, ihr physisches und auch psychisches Leiden an der Brutalität der Ereignisse am Isonzo wie in Südtirol. Angesprochen werden auch die Strafexpeditionen – nicht jene gegen die Zivilbevölkerung, aber doch jene gegen kleine Subordinationen in den eigenen Reihen. Hofbauer schildert die allgemeine Verrohung der Mannschaften, manchmal angeheizt durch die immer wieder aufbrechenden nationalen Differenzen in der Truppe. Er versucht dabei den Ton der einfachen Soldaten zu treffen, aber das will ihm nicht so recht gelingen. „Hast halt denkt, der Graben wir so ausschauen wia der im Prater, gelt […] I han’n a g’sehgn. War ja net viel eintritt zu zahl’n. Zu gunsten der Kriegsbeschädigtenfürsorge. Haha, hätt maUngarische Avantgarde-Zeitschrift (1916-1926, davon ab 1920 in Wien erschienen) Materialien und Quellen: Júlia Szabó: ... damals net denkt, daß i amol ohne Eintrittsgeld in an Graben komm‘!“ (MIC, 93) So ungeschickt polternd thematisiert einer der Kameraden das Staunen über den Zustand der Unterstände an der Front, der so gar nichts zu tun hat mit dem vom K.u.K. Kriegsfürsorgeamt angelegte Schützengraben im Prater, wo ein Orchester aus Kriegsversehrten für musikalischen Schwung sorgte und über den sich auch Kraus in den Letzten Tagen der Menschheit lustig macht11.
Der zentrale Kritikpunkt in Hofbauers Roman ist die prinzipielle Ungleichheit zwischen den chargen und den gemeinen Soldaten und der ,Verrat‘ all derer, die es sich im Hinterland richten an jenen, die ins Feuer geschickt werden. Mangelnde Kriegskameradschaft ist ein beliebter Erklärungsansatz für das Scheitern des Krieges aus konservativer Sicht. „Die verfluchten Tachinierer! […] die Tachinierer drücken sich herum im Hinterland und in der Etappe, sehen keinen Graben und fressen sich an – fressen uns alles weg – die dreckige Bagage …“ (MIC, 165) So schimpfen Dorniger und seine Kameraden vor sich hin, was den Koch, der sich’s gerichtet hat, nicht weiter berührt: „G’scheit muaß ma halt sein! Nur die Dummen müassen an die Front!“ (ebd.) Der Krieg macht nicht nur die „Pfiffigen“ deutlicher sichtbar, er modelliert auch die sozialen Unterschiede der Gesellschaft schärfer, weil sie über Nähe oder Ferne zum nahen Schlachtentod entscheiden. Gegen jene, die „es sich gerichtet haben“, allen voran seine Journalisten- und Schriftstellerkollegen, die im Kriegsarchiv oder Kriegsfürsorgeamt untergekommen sind, polemisiert auch Kraus in Die letzten Tagen der Menschheit unermüdlich. Immer wieder werden im Stück die besseren Söhne – auch und gerade aus Militärkreisen – eingespielt, die „hinauf“ gehen ins Kriegsministerium um es sich zu „richten“. Die Formulierung klingt humorig und nach der gemütlichen (alt)österreichischen Art, mit der sich die Oberen die Dinge in allen Lebenslagen zu regeln pflegen. Doch dass jene, „die die Menschheit wie eine Ware schieben, mit jenen, die die Ware schieben“12 in einer Personalunion verschmolzen, ergab ein Maximum an Machtfülle. Kraus selbst freilich war wegen einer Rückgratverkrümmung dienstuntauglich. Viermal musste allerdings auch er zur routinemäßigen Musterung antreten und dabei wusste er es sich einmal sogar terminlich zu richten. Er intervenierte im September 1915 bei seinem Bekannten, den Präsidenten der Wiener Reichsstatthalterei Alexander Friedrich Lothar Graf Castell-Rüdenhausen, um eine Urlaubsreise in die Schweiz wie geplant antreten zu können.13 Auch Hofbauers Landsturmrekrut Dorniger befolgt trotz seines Hasses auf die „elenden Drückeberger“ (MIC, 284) bei der ersten sich bietenden Gelegenheit die Ratschläge eines geschickten Tachinierers, was ihm – zumindest vorübergehend – zur Verwendung im Hinterland verhilft.
Überaus realistisch ist in Hofbauers Roman der kurze Epilog „Zehn Jahre später“. „Herr Prokurist Franz Dorniger, etwas in die Breite gegangen […] steht vor dem Spiegel und rasiert sich.“ (MIC, 339) Er hat mit einigen Verwundungen überlebt, die er, wie jene sichtbare Narbe an der Wange im Jahr 1928 schon als eine Art Auszeichnung trägt, die ihn von den Tachinierern unterscheidet. Zehn Jahre haben gereicht, die Erlebnisse im Krieg radikal umzufärben. „Das hat stark gemacht, dieses Leben an der Front! Die Front! Wie lustig war es doch manchmal in den Baracken“ (ebd., 340), denkt er nun und hat kein Verständnis mehr für seinen Freund, der die nachträgliche Verklärung des Geschehens durch die Überlebenden verweigert und bei seiner prinzipiellen Antikriegshaltung bleibt. Dorniger freut sich auf das Treffen der Veteranen und ist zutiefst gerührt, dass der Herr Bataillonskommandant selbst die Karte unterschrieben hat und alle mit „Werter Kamerad“ (ebd., 342) anredet.
Eine Art Kontrastprogramm zu Hofbauers Schützengrabenprosa ist der 1935 erschienene Roman Das Salz der Erde des galizischen Autors Joseph Wittlins. Bei Wittlin sehen wir kein Schlachtfeld und doch ist sein Roman eine der radikalsten Analysen der Unmenschlichkeit der Kriegsmaschinerie. Vorangestellt ist ein Prolog, der in poetischen Bildern von der Unterzeichnung der Kriegserklärung durch den Kaiser, ihrer Affichierung und den Reaktionen darauf erzählt:
Das geheimnisvolle Kriegsgespenst verdunkelte selbst das Bewußtsein der behäbigen Liebhaber des Pilsner Bieres. Ein seliger und tödlicher Schauer drang in die Herzen jener, denen die Apoplexie drohte. Irgendwelche verschwommenen und krassen Bilder erhoben sich aus alten, vergessenen Schulbüchern; losgelöste Visionen alter Schlachten, die von billigen Öldrucken her bekannt waren, aufgehängt in Friseurstuben, von Fliegen besprenkelt, fingen an, in das Innere bürgerlicher Seelen einzudringen und ihnen stürmisch ihre langjährige Ruhe zu rauben. Vor den Augen erstand plötzlich jenes Ideal der Ammen: der martialische Husar-Stiefelputzer mit dem schwarzen Schnurrbart ,Es ist erreicht‘, bekannt von den Reklameschildern für Schuhcreme. Irgend etwas zerbrach in den Hirnen aller. (SDE, 20)
Spielt der Prolog in Wien, führt der Roman selbst an den Rand der Monarchie, an die kleine Bahnstation Topory-Czernielitza, wo der 41-jährige huzulische Analphabet Peter Niewiadomski Hilfsdienste verrichtet. Kaisertreu durch und durch, fühlt er sich schon durch seine Nähe zur Eisenbahn dem Habsburgerhaus verpflichtet. Von den Ereignissen im Sommer 1914 versteht er wenig. Seinen Gestellungsbefehl muss er sich vorlesen lassen und zu den „Pfiffigen“, die es zum Tachinierer bringen, gehört er ganz gewiss nicht. Wittlin erzählt die Ereignisse vom Ausbruch des Krieges bis zur Eingliederung des Huzulen Niewiadomski in den Kriegsapparat mit einer poetischen Kraft, die das Ungeheure der Gewalttätigkeit greifbar macht. Die Gewalt zeigt sich in den Morden an der Russophilie verdächtigen Zivilisten genauso wie an den routinemäßigen Abläufen der Mobilmachung. Der Roman endet, bevor der gemeine Landsturmmann Niewiadomski und seine Schicksalsgenossen die Front erreichen – und dennoch ist die ganze Brutalität der Ereignisse präsent.
(7) Der Krieg lebt weiter
Jeder Krieg martialisiert die Gesellschaft und lebt in Männermythen und männerbündlerischen Strukturen fort. Nach 1918 fanden viele der entwurzelten Heimkehrer bei Frontkämpferverbänden Unterschlupf, die sich zunehmend radikalisierten und ein Reservoir für rechtsradikale Gruppierungen bildeten. In den Romanen der Zeit ist der desillusionierte Kriegsheimkehrer, der sich in der Nachkriegsrealität nicht mehr zurecht zu finden vermag, eine omnipräsente Figur. Und am Mythos der Kameradschaft im Feld schrieben auch Autoren mit, die den Krieg nicht mitgemacht haben.wie etwa Hugo von Hofmannsthalmit vollem Namen Hugo Laurenz Anton von Hofmannsthal geb. am 1.2.1874 in Wien – gest. 15.7.1929 in Rodaun bei Wien; Sc... in seinem Stück Der Schwierige.
Bereits am 25. März 1928, mehr als ein halbes Jahr bevor die erste Fortsetzung von Remarques Im Westen nichts Neues erschien, startete in der Berliner Illustrirte Zeitung der Abdruck von Leo Perutz‘ Roman Wohin rollst Du, Äpfelchen … Während die Spätfolgen des Krieges oft nur die Folie für das Scheitern männlicher Figuren abgeben, verlängert sich der Krieg in Perutz‘ Roman in Vittorins Leben immer weiter. „Meine Angelegenheiten sind […] in bester Ordnung. Sowie der Krieg aus ist, tret’ ich als Rechtskonsulent in die Kreditanstalt ein. Der Posten wartet schon auf mich.“ (WRD, 13) So optimistisch sieht Dr. Emperger im russischen Kriegsgefangenenlager seine Zukunft. Und er wird Recht behalten – die Kreditanstalt wird für ihn der sichere Hafen für ein geregeltes Leben und eine kleine Karriere. Deshalb bleibt er auch eine Randfigur im Roman. Die Literatur setzt in der Regel dort an, wo Lebensläufe nicht gelingen, wo das reibungslose Funktionieren der Alltäglichkeit plötzlich und gewaltsam aufgebrochen wird. So erzählt Perutz’ nicht die Geschichte von Emperger, sondern jene von Vittorin, der seiner Obsession verhaftet bleibt, für eine kleine Demütigung Rache am Kommandanten des russischen Kriegsgefangenenlagers zu nehmen und darüber den Anschluss an die Nachkriegsrealität verpasst. Nach Jahren sinnloser und beschwerlicher Reiseabenteuer in Russland stöbert Vittorin den Kommandanten tatsächlich auf, und zwar in Wien, wo er als verarmter Emigrant vom Verkauf bemalter russischer Puppen lebt. Jener Dr. Bamberger, der Vittorin vor Jahren den Posten eines Privatsekretärs angeboten hatte, ist inzwischen einer der größten „Wirtschaftskapitäne“ geworden – mit einem anderen Privatsekretär. Dass die Berliner Illustrirte Zeitung durch den Abdruck des Romans ihre Auflage um 30.000 Exemplare steigern konnte14, verdankte sich vielleicht nicht nur der Werbekampagne des Ullstein Verlages, sondern auch dem Romantitel. Die Formulierung – sie ist dem russischen Volkslied Ech, Jablotschko/Ach, Äpfelchen entlehnt – ergab ein griffiges Bild für das schicksalhafte Geworfensein der Soldaten im Hin und Her der Kriegshandlungen und Truppenverschiebungen.
Auch in Joseph Roths Roman Die Flucht ohne Ende hört der Krieg gleichsam nie auf. Franz Tunda gerät desertierend nach Sibirien, kämpft in der Revolution mit den Roten Garden, weil er sich in Natascha verliebt, die ihn nach dem Sieg der Revolution verlässt. Er kommt nach Baku, verliebt sich in die fast stumme Alja, bis eines Tage zufällig drei Reisende aus Paris seine Sehnsucht nach Österreich wecken, wo er vor dem Krieg mit Irene, Tochter des Bleistiftfabrikanten Hartmut, verlobt war. Als er in Österreich eintrifft, ist Irene längst in Paris verheiratet, als er ihr am Schluss des Romans zufällig begegnet, es ist bereits das Jahr 1926, erkennt sie ihn nicht. Tunda ist 32, ohne Perspektive, ohne Ziele, ohne Wünsche.
Hermann Brochgeb. am 1.11.1886 in Wien - gest. am 30.5.1951 in New Haven CT, USA; Schriftsteller, Kritiker, Industrieller, Exilant D... begann mit der Konzeption seiner Schlafwandler-Trilogie just im Jahr 1928, als die Welle der neuen Kriegsromane im deutschsprachigen Raum begann. Die ersten beiden Teile verhandeln im Milieu der preußischen Junker bzw. des verstörten Kleinbürgertums die Vorgeschichte. Teil drei Huguenau oder die Sachlichkeit, erschienen 1932, setzt im Jahr 1917 ein und zeigt nach Kriegsende an einer Reihe physisch wie psychisch zerstörter Figuren die Unmöglichkeit einer Wiedereingliederung ins Zivilleben. Ein verlorener Kriegsheimkehrer ist der verschüttete Landwehrmann Ludwig Gödicke, dessen erstes Lachen in einer schauerlich-grotesken Szene beschrieben wird, ebenso wie der Anwalt Heinrich Wendling oder Ingenieur Jaretzki, der einen Arm verloren hat. Er reicht „ein Offert bei der A.E.G.“ (SCHL, 442) ein; es sei „ein sentimentaler Versuch, ins Bürgerliche zurückzufinden, eine Karriere vor sich haben, nicht mehr Herumvögeln, Heiraten … aber daran glauben Sie ebensowenig wie ich“ (ebd., 443), sagt er zu Dr. Flurschütz. Auch der ist letztlich als Arzt im Lazarett noch nicht wieder im Zivilleben angekommen; für Flurschütz war es ein Geschäftsschild mit der Aufschrift „Tailleur pour Dames“, das unter den Brettern eines Unterstands bei Armentières hervorlugte und ihm das Ausmaß des Zivilisationsbruchs bewusst machte, „dort ist mir der ganze Wahnsinn erst richtig aufgegangen“ (ebd.). Flurschütz flieht in Zynismus. „Was wollen Sie, es war das Jahrhundert der Chirurgie, gekrönt von einem Weltkrieg mit Kanonen“, zudem sei Diabetes „erwiesenermaßen auf ein Minimum zurückgegangen“ (SCHL, 485), genauso wie Krebs, und die Prothetik habe durch die vom Krieg geschaffene Nachfrage einen wunderbaren Aufschwung genommen.
(8) Wie aber hat es dazu kommen können?
Wie die mentale Befindlichkeit kurz vor und unmittelbar nach Kriegsausbruch aussah, analysiert Max Brodgeb. am 27.5.1884 in Prag – gest. am 20.12.1968 in Tel Aviv; Schriftsteller, Kritiker, Herausgeber, Dramaturg, Komponi... in seinem 1932 erschienenen Roman Stefan Rott oder Das Jahr der Entscheidung. Er beschreibt, wie junge Gymnasiasten in Prag kurz vor Kriegsausbruch gedacht und gefühlt haben, in welchen gesellschaftlichen und familiären Konstellationen sie sich zurecht finden mussten, und mit welchen ideologischen Angeboten sie sich herumschlugen. Es ist kein Roman über die Schrecken eines autoritären Schulsystems, vielmehr geht es um die hoffnungslose Überforderung der Jugendlichen, mit den fatalen Verstrickungen der Erwachsenenwelt und ihren brüchigen Moralvorstellungen zurecht zu kommen, in der nichts so ist, wie es zu sein scheint und Kommunikationsakte daher fortwährend missglücken. Und so stolpert Stefan Rott durch seine verwirrenden Abenteuer, versucht zu verstehen, was ihm begegnet, zu reagieren, wie es von ihm erwartet wird – und ist dabei doch immer meilenweit entfernt von den Vorgängen, wie sie ,wirklich‘ sind oder zumindest von seinem jeweiligen Gegenüber intendiert waren.
Dann kommt das Attentat von Sarajevo. Stefan ist überzeugt, da „die Zeitungen doch von gebildeten Männern geschrieben wurden“, dass alle „gegen diesen Einbruch des Chaos in die Zivilisation ihre Fortschrittsstimmen erheben würden“. Das kommt bekanntlich ganz anders und mit einem Schlag wird dem juvenilen Schöngeist Stefan manches klar. Zum Beispiel der Zusammenhang von humanistischer Bildung und Kriegsvorbereitung:
Wir waren blind […] es handelt doch alles vom Krieg, was wir in der Schule gelesen haben. Cäsar, Homer, sogar Platons Staat regiert die Kaste der Krieger. Wie konnten wir glauben, […] daß es lauter Märchen sind, die man uns vorerzählt, daß das aufgehört hat, was immer und immer war. (STR 524f.)
Das ist eines der ganz wenigen Beispiele, wo der Zusammenhang von humanistischer Bildung und Kriegseuphorie angesprochen wird. Unter der Herrschaft des Rohrstabs verbrachten die männlichen Pubertierenden Jahre ihres Lebens mit dem Deklinieren und Konjugieren griechischer und lateinischer Nomen und Verben um die heroisierenden Schlachtenbeschreibungen ordnungsgemäß übersetzen zu können. Sie versorgten Generationen von jungen Männern mit synchronisierten Bildern der Weltgeschichte als lückenloser Folge von Siegen und Niederlagen militärischer Auseinandersetzungen. Die Bedingungen des autoritären Schulbetriebs wurden um 1900 vermehrt problematisiert, die vermittelten Inhalte nicht.
Bei Robert Musil hat sich nach der anfänglichen Kriegseuphorie rasch nach seiner Mobilisierung Ernüchterung breit gemacht, und die Analyse dieses Zustands der kollektiven Ekstase von 1914 wird ihn ein Leben lang beschäftigen, in seinem Stück Die Schwärmer (LINK-TEXT könnt ich noch machen) genauso wie im Roman Der Mann ohne Eigenschaften, der letztlich untersucht, was genau passiert, wenn „Seinesgleichen geschieht“ – so der Titel zum zweiten Teil des ersten Buches. Die zentrale Frage vieler Texte, die im literarhistorischen Blick dem Magris‘schen Verdikt des Habsburger Mythos zum Opfer fielen, ist letztlich: „Woran erkennt man den Krieg, bevor er da ist?“15 An der Figur des Lustmörders Moosbrugger und der Blicke auf ihn und seine Tat, vermisst Der Mann ohne Eigenschaften die dünne Grenze zum Bruch mit zivilisatorischen Normen. Die zentrale Funktion der Moosbrugger-Handlung für das Gesamt des Romans ist immer wieder untersucht worden, auch im Kontext der kriminologischen Debatten um 1900 – wobei die Mediendiskurse der 1920er Jahre für den Roman mindestens ebenso bedeutend sind. Beides ist für Musil jedoch weniger Ziel als Vehikel, um die mentalitätshistorische Vorbereitung des Ersten Weltkriegs zu untersuchen. Der Impuls für Musils Untersuchung der „Parallelaktion“ – und das gilt auch für Arthur Schnitzlers in diesem Zusammenhang selten genannte Komödie der Verführungvon Arthur Schnitzler Schnitzler hat an seiner Komödie der Verführung über zwei Jahrzehnte gearbeitet, bis der Krieg... (LINK-Text am Datei-Ende) – ist nicht Nostalgie, sondern Analyse, wie das „Seinesgleichen“ sich vorbereitet hat.
Literaturverzeichnis
- AK = Rudolf Geist: Der anonyme Krieg. Leipzig, Prag, New York, London, Wien: Internationale Buchpresse Heilbronn 1928.
- BF = Franz Werfeleigentlich Franz Viktor Werfel, geb. am 10.9.1890 in Prag – gest. 26.8.1945 in Beverly Hills, USA; Schriftsteller...: Barbara oder Die Frömmigkeit. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1996 (Gesammelte Werke in Einzelbänden).
- FG = Andreas Latzko: Friedensgericht. Zürich: Max Rascher 1918 (Europäische Bücher).
- FK = Andreas Latzko: Frauen im Krieg. Geleitworte zur Internationalen Frauenkonferenz für Völkerverständigung in Bern. Zürich: Max Rascher 1918.
- GPH = Rudolf Jeremias Kreutzeigentlich Rudolf Krisch, geb. am 2.2.1876 in Rozdalowitz, Böhmen - gest. am 3.9.1949 in Grundlsee, Steiermark; Schrift...: Die große Phrase. 2 Bde. Zürich: Rascher 1919.
- HO = Marie Eugenie delle Grazie: Homo … Der Roman einer Zeit. Wien, Berlin: Wiener literarische Anstalt 1919.
- KA = Rudolf Brunngraber: Karl und das zwanzigste Jahrhundert. Roman. Wien: Milena 2010 (ReVisited. 3).
- MIC = Josef Hofbauer: Der Marsch in chaos. Wien: Hans Epstein; Phaidon-Verlag 1930.
- MOE = Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. I. Erstes und Zweites Buch. Hg.: Adolf Frisé. 17. Aufl. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2003.
- NF = Arthur Holitscher: Der Narrenführer durch Paris und London. Mit Holzschnitten von Frans Masereel. Nachw.: Gert Mattenklott. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1986.
- SDE = Joseph Wittlin: Das Salz der Erde. A. d. Poln.: I. Bermann; Marianne Seeger. Frankfurt/M.: S. Fischer 1969.
- SCHL = Hermann Broch: Die Schlafwandler. Eine Romantrilogie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1978.
- STR = Max Brod: Stefan Rott oder Das Jahr der Entscheidung. Roman. Göttingen: Wallstein 2014.
- VLK = Stefan Großmann: Der Vorleser der Kaiserin. In: St. G.: Lenchen Demuth und andere Novellen. Berlin: Propyläen 1925, S. 106–122.
- WRD = Leo Perutzgeb. am 2.11.1882 in Prag – gest. am 25.8.1957 in Bad Ischl; Schriftsteller Als Sohn einer jüdischen Textilfabri...: Wohin rollst Du, Äpfelchen … Roman. Nachw.: Hans-Harald Müller. Reinbek: Rowohlt 1989.
Abbildungsverzeichnis
- Abb. 1: Cover zu Rudolf Jeremias Kreutz‘ Roman Die große Phrase. Erster Band (1919): Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien.
- Abb. 2: Cover zu Marie Eugenie delle Grazies Roman Homo (1919): Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien.
- Abb. 3: Cover zu Stefan Zweigs Roman Der Zwang, Neuauflage 1929: Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien.
- Abb. 4: Cover zu Rudolf Geists Roman Der anonyme Krieg (1928): Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien.
- Abb. 5: Cover zu Josef Hofbauers Roman Der Marsch ins Chaos (1930): Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien.
- Abb. 6: Cover zu Joseph Wittlins Roman Das Salz der Erde (1935): Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien/EB.
- Robert Musil: Europäertum, Krieg, Deutschtum. In: R.M.: Gesammelte Werke. Bd 8: Essays und Reden. Reinbek: Rowohlt 1978, S. 1020–1022, S. 1022. ↩
- Die Fackel. Nr. 857–863, Juli 1931, S. 118. ↩
- Abgedruckt ist der Briefwechsel in: Die Fackel. Jg. 23. Mai 1921, Nr. 568–571, S. 44–47. Der Strindberg-Preis wurde insgesamt nur zweimal vergeben, an Maximilian Harden und Theodor Lessing. ↩
- Stefan Zweig: Ypern. In: Ders.: Auf Reisen. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1993, S. 267–276. ↩
- Friedrich A. Kittler: Grammophon Film Typewriter. Berlin: Brinkmann & Bosse 1986, S. 148. ↩
- Elisabeth Nemeth: Wissenschaftliche Haltung und Bildsprache. Otto Neurath zur Visualisierung in den Sozialwissenschaften. In: IWK-Mitteilungen. 2009, Nr. 1-2, S. 31-42, S. 31. ↩
- Joseph Roth: Das journalistische Werk. 3 Bde. Bd 1. Hg., Nachw.: Klaus Westermann. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1989, S. 352f. ↩
- Oskar Maurus Fontana: Antlitz der Front. Berichte deutscher Dichter. In: Stefan Zweig: Der Zwang. Wien: Der Strom-Verlag 1929 (Die Roman-Rundschau. 2), 121–126, S. 121. ↩
- Stefan Zweig: Wondrak. Der Zwang. Zwei Erzählungen gegen den Krieg. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1994, S. 71. ↩
- Die Fackel. Jg. 30, 1929, Nr. 800–805, S. 72. ↩
- Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit. Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog. 2 Bde, München: dtv 1976 (Lizenzausgabe des Kösel-Verlags München nach der Originalfassung von 1926), Bd 2, Szene 8. ↩
- Karl Kraus: Wehr und Wucher. In: Die Fackel. Jg. 19, Nr. 457–461, 10.5.1917, S. 1–19, S. 18. ↩
- Marcel Atze: Karl Kraus wird nicht einrückend gemacht. In: „Es ist Frühling, und ich lebe noch“. Eine Geschichte des Ersten Weltkriegs in Infinitiven. Von Aufzeichnen bis Zensieren. Hg.: Marcel Atze, Kyra Waldner. St. Pölten, Salzburg, Wien: Residenz Verlag 2014, S. 284–287, S. 285. ↩
- Hans-Harald Müller: Leo Perutz. München: Beck 1992 (Beck’sche Reihe. 625. Autorenbücher), S. 54. ↩
- Franz Schuh: Krieg und Literatur. Vorläufige Thesen zu einer Bewußtseinsgeschichte des Ersten Weltkriegs. In: Österreich und der Große Krieg 1914–1918. Die andere Seite der Geschichte. Hg.: Klaus Amann, Hubert Lengauer. Wien: Brandstätter 1989, S. 8–16, S. 9. ↩