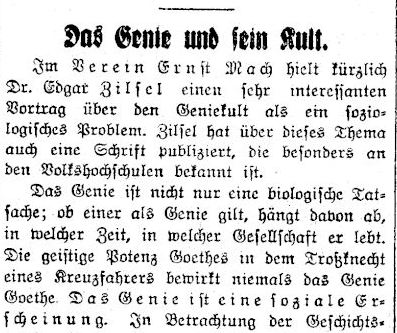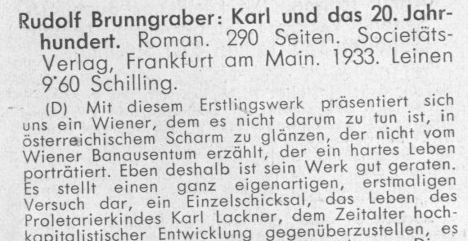„Die Wissenschaft mit dem bösen Blick“ auf dem Seziertisch der Literatur der 1920 und 1930er Jahre: Mathematik, Statistik und Literatur am Beispiel von Robert Musilgeb. am 6.11.1880 in Klagenfurt – gest. am 15.4.1942 in Genf; Schriftsteller, Essayist, Wissenschaftler, Theaterkritik..., Hermann Brochgeb. am 1.11.1886 in Wien - gest. am 30.5.1951 in New Haven CT, USA; Schriftsteller, Kritiker, Industrieller, Exilant D... und Rudolf Brunngraber
Wer mit Blick auf die Zwischenkriegszeit eine Spurensicherung zum Verhältnis von Mathematik und Literatur unternimmt, wird einerseits bald fündig und muss andererseits zur Kenntnis nehmen, dass dieses Verhältnis, das oft über Werkpläne nicht hinausgekommen ist (z.B. bei Hugo v. Hofmannsthal) oder in der Ausführung auf Episodisches begrenzt wurde (z.B. in Max Brods „Rebellische Herzen“), unter sehr unterschiedlichen Perspektiven zum Thema literarischer Arbeit gemacht worden ist bzw. in Erzähl- oder Romantexte Eingang gefunden hat. Auffällig ist jedenfalls, dass eine Reihe herausragender Schriftsteller schon aufgrund ihrer Ausbildung Affinitäten zur Mathematik bzw. zu einem exakten Wissenschaftsbegriff besessen und diesen auch in die literarische Arbeit eingebracht hat. Im Einzelnen haben sich dabei sehr unterschiedliche Zugänge und Texte ergeben, die im Folgenden rekonstruiert und zur Diskussion gestellt werden.
Von Primus-Heinz Kucher | Dezember 2017
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Überlegungen
- Musil und die Mathematik
- Mathematik – Die Wissenschaft mit dem bösen Blick
- Brochs Verhältnis zur Mathematik
- Glanz und Elend wissenschaftlicher Erkenntnis: Unbekannte Größen
- Statistik und Literatur
1. Einleitende Überlegungen
Dass die österreichische Literatur der Jahrhundertwende und darüber hinaus bis zum Beginn der 1930er Jahre intensiv von Erkenntnissen geprägt war, die sich zum einen den (von der Mathematik und Physik mitgebestimmten) Debatten rund um den Empiriokritizismus, der Metaphysik-Kritik von Ernst Machgeb. am 18.2.1838 in Chirlitz bei Brünn - gest. am 19.2.1916 in Vaterstetten; Physiker, Philosoph M. wurde 1838 al... im Besonderen verdankten, zum anderen mit entsprechenden akademischen Biographien einzelner ihrer Protagonisten verknüpfbar erscheinen, ist hinlänglich bekannt1. Von einem Paradigma kann aber selbst dort kaum gesprochen werden, wo wir aufgrund ähnlich gelagerter Bildungserfahrungen, d.h. einem Mathematik-Studium oder einer einbekannten Affinität zur Mathematik bzw. Technik, solches im Ansatz vermuten würden, d.h. im Fall von Hermann Broch, Robert Musil oder Leo Perutzgeb. am 2.11.1882 in Prag – gest. am 25.8.1957 in Bad Ischl; Schriftsteller Als Sohn einer jüdischen Textilfabri....
Karl Sigmund, Historiker der Mathematik mit Bezug zum Wiener Kreissiehe: Wissenschaftliche Weltauffassung
und der ihm nahestehenden Schriftsteller, hat in dem von W. Schmidt-Dengler 1998 herausgegebenen Band Fiction in Science – Science in Fiction gerade mit Bezug auf die oft genannte Trias Musil-Perutz-Broch die Frage aufgeworfen, warum sich Schriftsteller aus der ›kakanischen‹ Tradition heraus in den 1920er Jahren so intensiv der Mathematik zugewendet haben. Auf einer zunächst eher allgemeinen Ebene beantwortet Sigmund diese Frage mit dem Hinweis darauf, dass im spezifischen ›Laboratorium für den Weltuntergang‹ (bekanntlich eine Formel, die von K. Kraus stammt) die Wissenschaft der Mathematik, die vorgebliche Garantin für exaktes Wissen, seit der Jahrhundertwende eine hochdramatische Krise ihrer Grundlagen erlebt hat2. Diese muss folglich gerade jene Generation von Schriftstellern interessiert und herausgefordert haben, die sich selbst als Grenzgänger zwischen dem Exakten und Fiktiven, dem Realen und dem Phantastisch-Abgründigen in der einen oder anderen Form verstanden und bildungsmäßig eine hohe Affinität zu ihr entwickelt haben: Musil und Broch in erster Linie. In einer neueren Studie fasste Sigmund sowohl die Geschichte des Wiener Kreises als auch die Ausstrahlung auf die zeitgenössische Kunst und Literatur zusammen, wobei er das Spektrum im Literarischen auf Hugo Bettauergeb. als Hugo Maximilian Bettauer am 18.8.1872 in Baden – gest. am 26.3.1925 in Wien; Schriftsteller, Journalist, ... und Rudolf Brunngrabergeb. am 20.9.1901 in Wien – gest. am 5.4.1960 in Wien; Schriftsteller, Maler, Grafiker Ps.: Sverker Brunngraber (... ausweitete, im Bereich des Künstlerischen auf Tendenzen in der Architektur, im Besonderen um die (österreichische) Werkbund-Bewegung und die Vortragsaktivitäten des Verein Ernst Mach.3 Letzterer wurde anlässlich der Antrittsvorlesung von Rudolf Carnapgeb. am 18.05.1891 in Ronsdorf (heute Stadtteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen) – gest. am 14.09.1970 in Santa Mon... an der Prager Deutschen Universität im November 1931 von Felix Weltsch ausdrücklich als organisatorisches Zentrum der Wiener Schule der Philosophie gewürdigt.4
2. Musil und die Mathematik
Die mathematische Biographie Musils ist weitgehend bekannt und muss hier nur kurz rekapituliert werden: sie setzt 1898 mit dem Maschinenbaustudium in Brünn/Brno ein, erlebt um 1902-3 in Form einer Praktikantenerfahrung in Stuttgart in Verbindung zur Physik eine erste Ausweitung, sowie danach in Berlin unter Ernst Mach (ebenfalls in Verbindung mit der Physik, hier aber in der für das spätere Werk wichtigen, erweiterten Konstellation hin zur experimentellen Psychologie und Logik), um bis etwa 1908 im Zuge seiner Dissertation eine kontinuierliche und durchaus produktive Ausgestaltung zu erfahren5. Dieser Hintergrund wird als „mathematische Metaphorik“ im Denken wie im Schreiben bei Musil auch sichtbar (MHB, 510). Einen ersten Niederschlag kennen wir von der Erzählung Die Verwirrungen des jungen Törleß, vom Gespräch des jungen, der „furchtbaren Gleichgültigkeit“ eines Konvikts in einer abgelegenen Kleinstadt ausgesetzten Törleß mit seinem Mathematiklehrer über das Problem der ›imaginären Zahlen‹. Es erwächst aus der Hoffnung, jenen Geheimnissen auf die Spur zu kommen, die es schulmathematisch gesehen gar nicht geben dürfte wie z.B. eine wirkliche Zahl, „welche die Quadratwurzel von etwas Negativem wäre“, Geheimnisse, in denen Törleß eine Art „Vorbereitung für das Leben“ ahnt (MT,73)6.
Das Gespräch, zuerst ergebnislos mit seinem Konvikt-Gefährten Beineberg angefangen, läuft in einer von „Mißbehagen“ geprägten Atmosphäre ab, erscheint von wechselseitigem Missverstehen geprägt und lässt den jungen Mann recht unbefriedigt zurück:
…mit dem Übersinnlichen, jenseits der strengen Grenzen des Verstandes Liegenden, ist es eine ganz eigene Sache. Ich bin eigentlich nicht recht befugt, da einzugreifen, es gehört nicht zu meinem Gegenstande; man kann so und so darüber denken und ich möchte durchaus vermeiden, gegen irgend jemanden zu polemisieren […] Es geht nicht anders, lieber Törleß, die Mathematik ist eine Welt für sich, und man muß reichlich lange in ihr gelebt haben, um alles zu fühlen, was in ihr notwendig ist.“ (MT, 77)
Törleß, hinter dem Musil rückprojiziert durchwirkt, der zu jener Zeit sich sowohl mit dem Empiriokritizismus von Ernst Mach als auch mit den phänomenologischen Arbeiten von Edmund Husserl vertraut gemacht hat, also aus einem Bewusstseinshorizont heraus denkt und schreibt, der jener der als Autorität firmierenden Figur im Text klar überlegen war, muss hier vorerst resignieren und sein ahnendes Wissen als metaphorische Sehnsucht sublimieren.7 Das „tägliche Konkubinat mit der Mathematik“ (MT, 75) reicht offenbar nicht aus, um das Faszinierende und Beunruhigende hinter ihren Gesetzen zu erfassen.
Nach dem Törleß hat sich Musil programmatisch erst wieder 1913 in einem Essay der Mathematik zugewendet und zwar unter dem vielzitierten Titel Der mathematische Mensch. Ausgangspunkt seiner Überlegungen sind verschiedene Zuschreibungen, die an die Mathematik herangetragen werden, unter denen Musil jedoch nur wenige gelten lässt, z.B. jene, wonach die Mathematik „äußerste Ökonomie des Denkens“ sei. Allerdings darf hier auch der Nachsatz nicht unterschlagen werden, der das Denken generell als eine „weitläufige und unsichere Sache“ klassifiziert und somit die akzentuierte ‚Ökonomie‘ doch entscheidend eingrenzt. Musil umgibt sie von Beginn an mit einer Aura von Ambivalenz. Kann sie dabei „eine geistige Idealapparatur“ sein, „mit dem Zweck und Erfolg, alle überhaupt möglichen Fälle prinzipiell vorzudenken“8, so wird man wenig später freilich auch lesen, dass das eigentliche Gesicht dieser Wissenschaft erst dann ersichtlich werde, wenn man „nicht auf den Nutzen nach außen sieht“ sondern auf das Verhältnis ihrer Teile zueinander: „Es ist nicht zweckbedacht, sondern unökonomisch und leidenschaftlich“ (MM,1005). Der Mathematiker Musil schreibt ihr also weniger rationale als eher emotionale, „nicht- ratioide“ Qualitäten (so eine Tagebucheintragung in H. 10/1918-21) zu und spielt ihr vermeintlich hohes Ansehen für den Alltagsgebrauch geradezu dramatisch herunter, wenn er anmerkt:
Der gewöhnliche Mensch braucht von ihr nicht viel mehr als er in der Elementarschule lernt; der Ingenieur nur so viel, daß er sich in den Formelsammlungen eines technischen Taschenbuches zurechtfindet, was nicht viel ist; selbst der Physiker arbeitet gewöhnlich mit wenig differenzierten mathematischen Mitteln. (MM, 1005)
Von den durchschnittlichen Anwendungsmöglichkeiten her gesehen komme der Mathematik also kaum ein größerer Stellenwert zu als der eines Nebenfaches, genüge ja schon die Vermittlung der Grundrechnungsarten, um den Alltag zu bestehen oder die Kenntnis der wichtigsten Formeln für einen Spezialisten wie z.B. einen Ingenieur. Nichtsdestotrotz gebe es einen Raum, in dem sich die Mathematik weiter entfaltet, und zwar eine Art kaum betretenen wilden, nach innen gerichteten Raum, vergleichbar einem „ungeheuren Nervengeflecht“, das sich um einige wenige Muskel herum „angesammelt“ habe (MM,1006). Das ist der Raum, in dem nach ›Wahrheit‹ geforscht werde, ein Raum, der folglich weit mehr „Schicksal“ als Zweck bedeutet. Musil spricht von solcher – konzeptueller – Wissenschaft stets mit hohem Respekt – und verhaltener Ironie: „Die Mathematik ist Tapferkeitsluxus der reinen Ratio“ (Ebd), und er vergleicht sie mit der vom Nutzen her ebenfalls exponierten Philologie (deren Tun den in ihr Arbeitenden auch nicht immer klar sei), aber auch mit – passionierten Briefmarken- und Krawattensammler-Tätigkeiten.
Denn dieser Raum, so zwecklos nach Außen, ist insofern ein wichtiger Raum, als in ihm Denkoperationen stattfinden, Schlüsse zustande kommen, von denen wiederum andere profitieren, indem sie deren Schlüsse/Erkenntnisse mit eigenen Resultaten kombinierten wie z.B. Physiker und Techniker, um am Ende Maschinen zu konstruieren, die auch funktionieren, deren Innenleben aber mitunter auf recht tönernen Füßen stehe, was ihm gleich wieder implizit einen Beitrag, wenn nicht gar Bestätigung zur generellen Krise der Lebensform liefere. Manches, von dem wir meinen, es laufe ohnehin, könne nämlich durch eine mathematische Operation als höchst prekärer Zustand – die Unrettbarkeit des Ich z.B. – entlarvt werden. Daher, so wieder Musil: „Es gibt heute keine zweite Möglichkeit so phantastischen Gefühls wie die des Mathematikers“ (MM, 1006). Erst das Wissen um diese herausragende Stellung macht den mathematisch-physikalischen Menschen aus, ein Wissen, das die „verteufelte Gefährlichkeit seines Verstandes“ einschließt (MM, 1007), ohne gleich die theoretische Möglichkeit – z.B. die Infragestellung von Raum oder Zeit – mit derselben Konsequenz Wirklichkeit werden zu lassen, mit der sie als solche skizziert werden kann. Was kann daraus für die Dichtung gewonnen werden, fragt sich Musil abschließend? Sein Versuch einer Antwort lautet: die Einsicht, dass es nicht so sehr um das Wissen, als vielmehr um das Denken gehe, um eine Bewegung in die Tiefe, die Kühnheit und Neuheit in Aussicht stelle, weshalb der mathematische Mensch eine Analogie sein könne, „für den geistigen Menschen, der kommen wird“(MM, 1007), -aber auch ein Korrektiv zur zeitgenössischen Dichtung. Deren Lektüre, insbesondere von Romanen, verlange geradezu danach, daraufhin „ein Integral auf[zu]lösen, um abzumagern“ (MM, 1005).
Vor der ersten intensiveren Arbeitsphase am Roman MOE fühlt sich Musil 1919-20 bekanntlich durch die wirkungsmächtige Schrift Der Untergang des Abendlandes von Oswald SpenglerBezieht sich vorwiegend auf Oswald Spenglers (1880-1936) Schrift Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologi... in die Quere, die ihn zu einer der gleichermaßen profundesten wie pointiertesten Abrechnungen mit dessen „Überfließen einer lyrischen Ungenauigkeit in die Gevierte der Vernunft“ (GE, 1058) anregte, in der in der abschließenden Conclusio auch das vielzitierte Begriffspaar des ›ratioïden‹ und ›nicht-ratioïden‹ eingeführt wird (Kucher, 1984, Béhar, 2002, Schwandtner 2013).9
3. Mathematik – Die Wissenschaft mit dem bösen Blick?
Es wundert nicht wirklich, dass in die Konfiguration der Protagonisten-Gestalt des epochalen Romans Der Mann ohne Eigenschaften, d.h. in die Figur Ulrich, Manches, ja Wesentliches aus den frühen Reflexionen über die Mathematik Eingang gefunden hat. Bereits Musil selbst, aber auch die frühe Musil-Forschung hat hierzu die Formel von der ›Genauigkeit‹ und der ›Seele‹ bzw. mit Bezug auf den abgebrochenen Form, über die Technik, Mechanik und Mathematik ein „ungewöhnlicher“ und bedeutender Mensch zu werden das ‹ins Ironische gewendete Bild vom „Rechenschieber“ zwecks Feststellung möglicher „Fehlergrenzen“ im Umfeld von „großen Behauptungen oder großen Gefühlen“ (MOE, I, 37; Rasch, 95, Gschwandtner, 135) geprägt.
Diese kritische und ironische Reflexion beginnt bereits im vierten Kapitel, in dem zum ersten Mal eine wesentliche Koordinate des Romans angesprochen wird: die dialektische Beziehung zwischen ›Wirklichkeitssinn‹ und ›Möglichkeitssinn‹ und zwar dergestalt, dass die Wirklichkeit als faktische Dimension es sei, „welche die Möglichkeiten weckt“ und einen „bewußten Utopismus“ zur Folge habe (MOE, 1,17)10. Dies setze ein Denken in Gang, das auf Ideen als noch nicht geborene Wirklichkeiten abstelle und eine Figur präfiguriere, die „keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit“ sein könne bzw. müsse (Ebd.). Von Ulrich heißt es daher, kaum dass er erstmals namentlich im Roman auftritt: „Es ist schon angedeutet worden, daß er Mathematiker war, und mehr braucht davon noch nicht gesagt zu werden.“ (MOE, 1, 19).
Worauf dieses ›mehr‹ zielt, erschließt sich ein wenig aus Entwurfsnotizen aus einer frühen Arbeitsphase (d.h. um 1919/20), als Ulrich noch den Namen A[chilles] trug. Diese Notizen stehen unter der Überschrift: Mathematik. Die Wissenschaft mit dem bösen Blick. Sie schließen thematisch an den ersten Versuch an, im Leben über eine bedeutende Tätigkeit Fuß zu fassen, d.h. wie im Roman über den Umweg einer militärischen Laufbahn – „Schule der Rohheit“ – aus der grauen Existenz eines Durchschnittslebens herauszutreten:
Es erschien ihm folgerichtig, daß er sein Leben noch einmal ändere und er beschloß, um an die Quellen zu gehen, Mathematiker zu werden. Denn er erkannte, daß diese scheinbar lebloseste Wissenschaft das Geheimnis des Lebens selbst umschließe. (MOE, 5, 1979)11
Dazu passt auch folgende Tagebucheintragung: „Typen, aus denen sich die Handlung aufbaut, müssen konstitutiv für das heutige Leben sein. Etwa: Der Schachspieler und der Mathematiker…“ (TB, H21, 578)
Neben dem Umstand, dass diese Wissenschaft „keinen anderen Inhalt hat, als sich selbst“, also eine unbegrenzte, durch keine Metaphysik oder Moral (beides war ihm „verdorben“, so ebenfalls in dieser Eintragung) eingegrenzte Denkfläche zu versprechen schien, in der man dem Geheimnis des Lebens auf die Spur kommen könne, zählte zu ihrem Faszinosum offenbar eine geheimnisumwitterte, auch sadistische Komponente, aus der Lust und Erkenntnis gleichsam als begleitende Befriedigungen gezogen würden: als „Das Großartige dieser Wissenschaft, Temperamentvolle usw.“ figuriere nämlich auch „eine gewisse Neigung zum Bösen“ (Ebd.).
Diese hohe Erwartungshaltung an die Mathematik wird allerdings schon in den Entwürfen alsbald relativiert: wie andere Wissenschaften, auf die A. sich einzulassen gewagt hatte, er erwähnt z.B. die Philosophie, stellte sich ein Gefühl der Enttäuschung ein: der „harte globe trotter Typus“, der ihm dabei vorschwebte, wollte sich nicht recht einstellen. So erscheint ihm die Mathematik – wie anderes auch – doch nur „als Vorbereitung auf etwas, das nicht kam“, – aber immerhin als notwendige Vorbereitung, die er zu den drei großen Leidenschaften rechnet, die dieser angestrebte Typus bisher erfahren durfte: „Sex, Sport, Mathematik u. Technik“ (MoE, 5, 1980), – eine gewiss ungewöhnliche, aber vom Denkansatz, wie ihn Musil zu entwickeln versucht hat, schlüssige Denk- und Lebensoption.
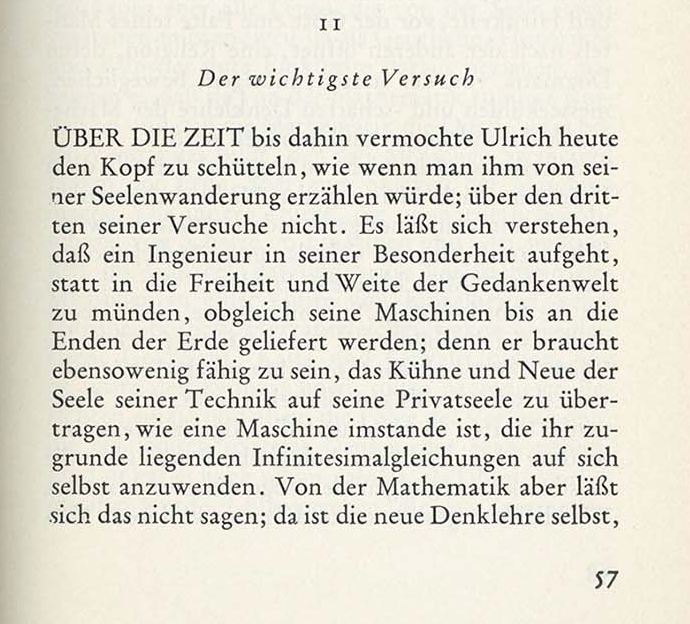
Ulrich, um wieder zur (definitiven) Romanfassung zurückzukehren, war bekanntlich da und dort gewesen, hat „Wertvolles und Nutzloses getrieben“ und kommt nach etwa 16jähriger Abwesenheit im 32. Lebensjahr stehend in seine Heimatstadt (wohl Wien) zurück. Sein Anspruch scheint verständlich zu sein: er versucht sich einzurichten, und er tut dies auch, weil er sich im Klaren darüber geworden ist, dass seine drei wichtigsten Versuche, „ein bedeutender Mann zu werden“ gescheitert waren: jener, Napoleon vor Augen, beim Militär zu reüssieren ebenso wie jener, über die Lehrsäle der Mechanik „auf dem Wege der Technik“ als Ingenieur die Welt zu erobern (MOE, 1, 37). Zwar besitze gerade letzteres einen faszinierenden Anflug dessen, was gewöhnlich mit archetypischen Träumen und deren Realisierung zu tun habe: das Fliegen, der Rausch der Geschwindigkeit, das Eintauchen in ein Berginneres vergleichbar einer Fahrt durch einen Eisenbahntunnel, sodass es den Anschein habe, „daß die Mathematik wie ein Dämon in alle Anwendungen unseres Lebens gefahren ist“ (MOE, 1, 39f.), eine gefährliche Wissenschaft, die zugleich den dritten und „wichtigsten Versuch“ bildet, ein „ungewöhnlicher Mann zu werden“ (MOE, 1,38). Dieses Dämonische wiederum, das die Verwirklichung von Abenteuern in Aussicht stelle, sei freilich oft auch von einer neuen, dogmatischen Religion mitgeprägt, die auf innere Entseelung setze, in der „die Mathematik die Quelle eines bösen Verstandes bilde, der den Menschen zum Herrn der Erde, aber zum Sklaven der Maschine mache“ (MOE,1 40).
Darüber hinaus werde von Manchen behauptet, dass „die innere Dürre, die ungeheuerliche Mischung von Schärfe im Einzelnen und Gleichgültigkeit im Ganzen“, die zur Vereinzelung vieler Menschen führe, aber auch zur Kälte und Gewalttätigkeit, „wie sie unsre Zeit kennzeichnen“ auch Ergebnisse bzw. Konsequenzen seien, „die ein logisch scharfes Denken der Seele zufügt!“ habe (Ebd.) Selbst der anstehende Zusammenbruch der europäischen Kultur wäre in diesem Zusammenhang zu sehen, wobei Musil freilich anmerkt, dass jene Propheten „bezeichnenderweise […] alle in ihrer Jugend- und Schulzeit schlechte Mathematiker gewesen [sind]“ und vielleicht gerade deshalb unfähig wären, die Konsequenzen ihres Tuns, wonach die Mathematik nicht nur „Großmutter der Technik“ sondern auch „Erzmutter jenes Geistes ist, aus dem schließlich Giftgas und Kampfflieger aufsteigen“ (Ebd., S.40) zu erkennen.
Diese negativen Zuschreibungen halten Ulrich nicht davon ab, sich der Mathematik zuzuwenden, allerdings sie auf seine ganz spezifische Weise zu lieben, nämlich weniger als Wissenschaft denn als Laboratorium für ungewöhnliche Fragestellungen:
Von Ulrich dagegen konnte man mit Sicherheit das Eine sagen, daß er die Mathematik liebte, wegen der Menschen, die sie nicht ausstehen mochten. Er war weniger wissenschaftlich als menschlich verliebt in die Wissenschaft. Er sah, daß sie in allen Fragen, wo sie sich für zuständig hält, anders denkt als gewöhnliche Menschen.“ (MoE, 1, 40)
Es ist also gerade dieses Beharren auf ein ›anderes Denken‹, auf die Möglichkeit, alles umzustürzen, das bislang Geltung hatte, auf die Vorstellung, ›Himmelsleitern‹ zu bauen, wo solche undenkbar erscheinen und sich somit spezifische Imaginationsräume zu erobern, die Ulrich, resp. Musil mit der Unbekümmertheit eines Märchens – da drängt sich ein Vergleich Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann auf – kurzschließt (Ebd., 41).
Je mehr dieses andere, radikale Denken in den Vordergrund tritt und in den Begegnungen mit den anderen Figuren des Romans sowie in den überhandnehmenden Reflexionen über dabei gemachte Wahrnehmungen durchexerziert wird, desto stärker tritt die Mathematik als dieses Denken mittragende Wissenschaft in den Hintergrund. Fast gewinnt man den Eindruck, sie gehe insgesamt in den Begriff Wissenschaft auf, der zugleich durch die Ulrich immer wieder fordernde Banalität von Alltagsbeziehungen an Konsistenz zu verlieren scheint. So heißt es im vielzitierten Kap. 13 über ein ›geniales Rennpferd‹ das ebenfalls ein ›Mann ohne Eigenschaften‹ sein möchte, dass die Wissenschaft einer Anstrengung gleiche, die im Unterschied zum Besteigen einer Bergkette sich dem dabei zu erwartenden Genuss – eine Aussicht oder ein Ziel, das näher rückt, irgendwann auch zu erreichen – eher entziehe bzw. ähnlich einer Zirkelbewegung letztlich nur in Aussicht stelle, was ohnehin schon Ausgangspunkt war: „…Bruchstücke einer neuen Art zu denken wie zu fühlen.“ (MOE, 1, 46)
Wie solches auf der Ebene der Romanhandlung, d.h. neben den essayistischen Reflexionen, sichtbar werden kann, zeigt z.B. eine Überlegung im Kapitel 34, die Ulrich im Anschluss an den Bruch mit Bonadea (seiner zweiten Geliebten, die auch nach ›hohen Ideen‹ strebte, so anfangs über sie) anstellt. Nach dieser Anstrengung (d.h. Bonadea zu verabschieden) fühlt er sich wieder frei und „sein Inneres mit Bewegungsformen des Geistes angefüllt, es in gut gegeneinander exerzierenden Gruppen von Gedanken zerlegt“ (MoE,1, 129), um gleich in die quälende Selbstbefragung überzuleiten, ob denn „die WahrheitBereits 1895 vom Kantor der sephardischen Gemeinde in Wien, Jakob Bauer, vor dem Hintergrund des anwachsenden Antisemiti..., die ich kennen lerne, meine Wahrheit[ist], die Stimmen, die Wirklichkeit, all das Verführerische, das lockt und leitet […] denn die wirkliche Wirklichkeit [ist]…“ (Ebd., 129). Man fühlt sich hier unweigerlich an die Überlegungen Ernst Machs in der Analyse der Empfindungen erinnert, wenn von der zufälligen Ansammlung von Elementen die Rede ist – „Nicht das Ich ist das Primäre, sondern die Elemente (Empfindungen) […] Sie bilden das Ich…“ –, die ein Ich, ein Subjekt, aber damit auch eine bestimmte Manifestation von Wirklichkeit ausmachen, die keineswegs als stabile, sondern eher als prekäre, ja unrettbare angesehen wird12
Wie bereits angesprochen, tritt das explizit Mathematische bereits ab dem zweiten Teil des ersten Buches (d.h. schon nach 20 Kapiteln), das bekanntlich unter dem Motto ›Seinesgleichen geschieht‹ steht, aus der konkreten Textoberfläche zurück. Es verschwindet aber nicht vollkommen aus der Anlage des Romans und schon gar nicht aus den Denkbewegungen seines Protagonisten Ulrich. Eine Verbindung mit ihr bleibt – subkutan – aufrecht, indem Ulrich wiederholt auf dieses ›andere Denken‹ Bezug nimmt, aber auch dem – der Mathematik zugeschriebenen – subversiv-dämonischen Gestus huldigt: letzterer erscheint z.B. als „eine biegsame Dialektik des Gefühls, die ihn leicht dazu verleitet, in etwas, das allgemein gut geheißen wird, einen Schaden zu entdecken, dagegen etwas Verbotenes zu verteidigen.“ (MOE, 1, 151) Diese Haltung wird von ihm selbst mit dem Bild der Welt als ein Laboratorium erläutert, in dem „die besten Arten, Mensch zu sein, durchgeprobt und neue entdeckt werden müssten“ (Ebd., 152). Wir können also eine naturwissenschaftlich-experimentelle Basis für nachfolgende Ideensammlungen und personelle Konstellationen annehmen, die – so der Grundverdacht – dazu dienen, die Absurdität des ›Seinesgleichen‹ nicht nur zu befragen und ironisch darzulegen, sondern diese zudem mit bewundernswerter Ausdauer bloßzustellen und Türen aufzustoßen in noch Unbetretenes. Es wundert daher nicht, wenn Ulrich im (61.) Kapitel Das Ideal der drei Abhandlungen oder die Utopie des exakten Lebens im Zusammenhang mit der Frage, ob es denn nicht zweckmäßig wäre, dem Leben mehr Wissenschaftlichkeit zu unterlegen, um nicht das „menschliche Geschäft äußerst unrationell zu betreiben“ (MOE,1, 245) den für den Roman wichtigen Utopie-Begriff mit dem des Experiments kurzschließt:
Utopie bedeutet das Experiment, worin die mögliche Veränderung eines Elements und die Wirkungen beobachtet werden, die sie in jener zusammengesetzten Erscheinung hervorrufen würde, die wir Leben nennen. Ist nun das beobachtete Element die Exaktheit selbst, hebt man es heraus und läßt es sich entwickeln, betrachtet man als Denkgewohnheit und Lebenshaltung und läßt es seine beispielgebende Kraft auf alles auswirken, was mit ihm in Berührung kommt, so wird man zu einem Menschen geführt, in dem eine paradoxe Verbindung von Genauigkeit und Unbestimmtheit stattfindet […] (MOE, 1, 246)
Diese Menschen gebe es auch in der Wirklichkeit, z.B. „nicht nur im Forscher, sondern auch im Kaufmann, im Organisator, im Sportsmann, im Techniker…“ (Ebd.)
Vielleicht ließe sich die These formulieren, dass erst dieser spezifische, mathematisch-subversive Geist, der z.B. das Exakte als „paradoxe Verbindung von Genauigkeit und Unbestimmtheit“ definiert (und somit die auf die Relativität des Exaktheitsaxioms vorausweist), es möglich mache, die Alltagsanwendungen der Mathematik (aber auch jene anderer Wissenschaften, z.B. der Pädagogik etwa in Gestalt des mediokren professoralen Gatten der Schwester Agathe oder der Philosophin Gestalt und Nietzsche-Schwärmerin Clarisse) auf ihre ideologischen Verkrustungen und peinlichen Institutionalisierungen hin entsprechend zu markieren.
Ein instruktives Beispiel bietet hierfür das Kapitel 85, in dem die skurrile Figur des Generals Stumm von Bordwehr versucht „Ordnung in den Zivilverstand“ zu bringen und dabei zu einer Kartierung der Kultur ansetzt, um daraus, so Stumm, „das Grundbuchblatt der modernen Kultur“ zu gewinnen. Es handelt sich dabei um Eintragungen in eine Matrix, deren mathematische Grundlage zwar nicht mehr benannt wird, aber doch durchscheint (MOE, 2, 372). Das daraus sich entspinnende Gespräch macht deutlich, mit welcher Präzision Musil es versteht, die durch zwei Leutnants und fünf Unteroffiziere im Zuge von Befragungen gewonnene Statistik, die den Generalstäbler sichtlich irritiert, weil sich zu jeder großen Idee gleich auch schon eine Gegenidee ausfindig machen lasse, ironisch auf den Grundansatz prallen zu lassen, mittels der Statistik die Ideenlandschaft der Zeit vermessen zu wollen. Als sich der General dazu versteigt, die unübersichtliche Aufstellung von Ideen im Sinn eines Schlachtfelds von Gedankengruppen auf weiteren Skizzenblättern festzuhalten und nach Erklärungen über sich verschiebende Frontverläufe sucht, motiviert dies Ulrich zum entwaffnenden Einwand, man dürfe doch das Denken nicht so ernst nehmen, wie dies Manche beim Militär täten. (Ebd. 375).
Liegt in einer so verstandenen ironischen Absage an das Denken durch den analytisch-experimentellen Denker Ulrich nicht schon jene mehrmals angesprochene Radikalität, deren Grund u.a. auch die mathematische Disposition ist? Auf diese Frage, auf die es nach 1600 Romanseiten keine eindeutige Antwort gibt, hat Musil auf einem Nachlassblatt vielleicht die einzig plausible zu geben versucht, wenn er über den MOE festhält: „Seine Eigenschaften bestimmen ihn und gehören nicht zu ihm. Alles ist ambivalent und darum ist jede Antwort eine Teilantwort usw.“13
4. Brochs Verhältnis zur Mathematik
Ungefähr zur gleichen Zeit, als Musil sich mit der konzeptuellen Anlage seines Romans sowie mit der Ausgestaltung des ersten Bandes beschäftigte, d.h. seit Beginn der 1920er Jahre trat mit Hermann Broch eine weitere Intellektuellen- und Schriftstellerfigur auf den Plan, die nicht nur der Mathematik in vergleichbarer Weise verpflichtet war, sondern auch von maßgeblichen Exponenten des Wiener Kreises Impulse erhielt bzw. mit ihnen im Austausch stand. Zur Mathematik hat Broch im Spätsommer 1920 über private Studien mit dem jungen Mathematiker Ludwig Hofmann gefunden, offenbar, um diese in eine philosophisch-erkenntnistheoretischen Projekte zu integrieren (LBB,96). In sein Teesdorfer Tagebuch notierte er jedenfalls am 10.-11.10. 1920: „Heute abend ist mir die Philosophie der Mathematik in Manchem klarer geworden“. Die geplante Arbeit Das mathematische Interesse ist allerdings nicht zustande gekommen, obwohl auch in den hochprivaten Eintragungen für Ea von Allesch mehrere Verweise auf Mathematisches, z.B. auf die Euklidische Geometrie, zu finden sind.14 Zwischen 1925 und 1930 betreibt Broch an der Universität Wien intensiv philosophische und mathematische Studien, u.a. bei Rudolf Carnap, bei dem er nicht nur Seminare und Vorlesungen zur Raumtheorie und zur Theoretischen Philosophie, sondern auch eine Vorlesung zu Grundlagen der Arithmetik belegt. Bei Hans Hahn, Karl Menger und Wilhelm Wirtinger besucht er eine Reihe von Lehrveranstaltungen zur Mengenlehre, Analytischen Geometrie, Funktionstheorie, Differential- und Integralrechnung oder zur Kurventheorie, bei Moritz Schlick Philosophie der Mathematik und Algebra sowie Zahlentheorie bei Philipp Furtwängler, ergänzt um erkenntnistheoretische Angebote durch Viktor Kraft und Moritz Schlick, – insgesamt eine solide Basis für seine mathematisch-philosophischen Interessenslagen (LBB, 97).
Aufgrund der programmatischen Ausgrenzung der Metaphysik aus dem wissenschaftlichen und philosophischen Denken hat er sich von diesem Kreis Anfang der 1930er Jahre wieder abgewendet. Die strukturellen Differenzen lassen sich in der lange unveröffentlicht gebliebenen essayistischen Skizze (EV in WA, Bd. 10/1, 1977) Die sogenannten philosophischen Grundlagen einer empirischen Wissenschaft fassen bzw. erahnen. Dort werden – im Kontext einer – komplexen Debatte über die nicht reduziblen Reste dieser Wissenschaft – Broch führt dies an der nicht-euklidischen Geometrie und an metaphysisch grundierten Fragen der Axiomsproblematik weiter aus – unter einem Katalog von noch abzuklärenden methodologischen „Restbeständen der Mathematik“ an erster Stelle die „metaphysischen Fragen der mathematischen Wirklichkeitsgeltung“ (KW,10,1,132) angeführt. Im zweiten Teil dieses Essays, der sich mit dem Verhältnis von Positivismus und Wirklichkeit befasst, bekräftigt Broch seine Skepsis über metaphysikfreies Denken und Erkenntnis, indem er mit Verweis auf die positivistische Wissenschaftstradition seit Comte bis Mach auf deren jeweiligen Anteile an Intuition – als die „metaphysischste aller Metaphysiken“ – verwies (Ebd, 142).
5. Glanz und Elend wissenschaftlicher Erkenntnis: Unbekannte Größen
Wie lös- und unlösbaren Fragen der Mathematik auf literarischer Ebene von Broch aufgegriffen und durchgearbeitet wurden, zeigt sein Roman Die Unbekannte Größe (1933). Zu ihm hat Broch ein programmatisches Nachwort, Grundzüge zum Roman Die Unbekannte Größe, sowie ein Filmskript Das unbekannte X verfasst, das über die Romanhandlung hinausreicht und plakativ gegen eine metaphysikfreie, logisch-empirische Erkenntnismöglichkeit argumentiert. Aus diesen die Romanarbeit begleitenden Überlegungen und Nachbereitungen, aber auch aus Briefstellen, welche sich mit der Aufnahme des Romans befassen15, lässt sich ablesen, dass Broch, der sich im US-amerikanischen Exil nicht mehr zu diesem Text bekennen wollte, sich 1933 intensiv und mit wechselnder Nähe/Distanz zur Thematik auf die angedeuteten Fragen, insbesondere auf die über die Romanhandlung hinausreichende, wie ein Mensch, „von einer Einzelwissenschaft kommend, zu Lösung des rational unbewältigbaren Erkenntnisrestes (manifestiert in den großen Fragen des Todes, der Liebe, des Nebenmenschen) gelangen“ könne (UG, 245).
Broch folgt in seinem Roman (UG) – deutlicher als Musil in seinem MoE – zunächst zeitgenössischen, d.h. wissenschaftlichen Vorstellungen im Hinblick auf die Mathematik, deren Herausforderungen und möglichen Lösungen durch einen mathematischen Menschen, der im Roman Richard Hieck heißt und gerade promoviert hatte. Dies geschieht durchaus im Zweifel, in Ungewissheit und quasireligiöser Versenkung – „Er wollte mit der Mathematik etwas erzwecken, das so außerhalb der Mathematik lag wie Christus außerhalb der ihm dienenden Kirche, doch er gelangte niemals über die internen mathematischen Zwecke hinaus“ (UG, 30) – dann auch im konventionellen Austausch mit Kollegen und seinem Lehrer und schließlich im Zuge einer „Art Erleuchtung“, die ihm die Mathematik wie „ein helles Netz leuchtender Wirklichkeiten“ (UG,39) erscheinen lassen, getrieben von wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse. Seine „kühnste Lebenshoffnung“ fasst er z.B. in Sätze wie „…wenn es gelänge, eine neue mathematische Disziplin zu erfinden, gleich Leibnitz die Infinitesimalrechnung, gleich Cantor die Mengenlehre, wenn es gelänge, dem Wunder der Dimensionalität auf die Spur zu kommen…“ (UG, 63) oder „daß ihm das Mathematische als Rettung vor der Sünde erschien“ (UG, 64). Als jedoch zwei Studentinnen als Hilfskräfte in den Institutsbetrieb eintreten (Erna Magnus und Ilse Nydhalm), gerät das vermeintlich logische, stabile wissenschaftlich-mathematische Weltbild Hiecks zunehmend in Bedrängnis. Es wird nämlich kontrastiert durch etwas, das er nur vage fühlen kann und das mit ›Leben‹, in kurzen lichten Momenten auch mit Liebe und Eros, kurzgeschlossen, zugleich aber aus seinem logischen Denken, nicht aber aus seiner Psyche ausgeschlossen wird. Mit ihnen, zuvor aber auch schon mit den mystischen Vorstellungen seiner Schwester, tritt nämlich die „Unberechenbarkeit der Welt“ unübersehbar im Gegensatz zu den klaren Herausforderungen der Mathematik in seinen Horizont, etwa, wenn er sich die Studentin im Badekostüm vorstellt, aber auch, wenn er seinen Lehrer körperlich verfallen sieht. Solches gelte es abzuwehren, erscheint es ihm als „Verrat an der Mathematik“ (UG, 81): „Strikte lehnte er es ab“ – in den lehrerhaft wirkenden Gesprächen mit Ilse – „die objektiven Ziele der Wissenschaft mit subjektiven zu verquicken.“ (UG, 82) Doch beim Besuch einer Sternwarte, den Hieck dazu nützt, Ilse mit der Einsteinschen Hypothese vom gekrümmten Weltraum sowie dem „Zusammenhang der kleinsten nichteuklidischen Raumteile mit dem nichteuklidischen Gesamtraum“ (UG, 97) zu beeindrucken, erodiert sein wissenschaftliches Weltverständnis, seine Anstrengung „die ganze Welt im Spiegel der Mathematik zu erfassen“ (UG, 98) angesichts eines Blicks auf ihr Sommerkleid:
Das Wesentliche ist nicht ausdrückbar. Die letzte Wahrheit und die tiefste Sünde, Grenzen des Wortes […] er vermied es, dem Blick Ilses zu begegnen. Die Liebe.“ (UG, 98)
Von diesem Moment an wird auch das Sprechen über Mathematik ambivalent, wird sich Richard Hieck immer mehr bewusst, dass „Die letzte Begründung der Mathematik [] außerhalb der Mathematik liegt und doch in ihr“ (UG,120), ähnlich dem letzten Ziel des Seins oder der Liebe, woraus in der Folge Fluchtgedanken aus dem einst sicheren, nun doppelbödigen Raum der Wissenschaft erwachsen. Zwar fehlt den beiden die nötige Sprache einer Verständigung außerhalb jener der Wissenschaft, weshalb diese Flucht nicht in eine gemeinsame umgesetzt werden kann. Indem diese Schwierigkeit sichtbar gemacht und der Zweifel als Stachel des Nicht-Rationalen überhand gewinnt, gelingt Broch eine unaufdringliche Verbindung zwischen seinen philosophischen Überlegungen, die sich der unsystematischen Form des Gespräches bedienen, und der fiktionalen Narration über das langsame Herauskippen des Mathematikers Hieck aus seinen anfänglichen Gewissheiten und wissenschaftlichen Ambitionen, wie dies Cliver mit Blick auf die Broch-Literatur auch schlüssig zusammengefasst hat (HB-Cliver, 117f.)
Als sich herausstellt, dass die Mathematik für die Bewältigung der eigentlichen Fragen des Lebens (neben der Liebe ist es v.a. der rätselhaft bleibende Freitod des Bruders), keine tauglichen Antworten geben kann, ja ein Kollege (Kapperbrunn) gegen die Wissenschaft das Leben am Beispiel des Kletterns in einer Bergwand anführt und das Streben nach Erkenntnis als lächerlich denunziert – „Erkenntnis ist ein großer Dreck“ (UG, 140) – wendet sich Hieck am Ende schließlich von der Wissenschaft ab und dem Leben zu:
„Draußen rauscht das Leben, fernab, unerfaßbar, ungeheuer, unerschöpflich, aber es rauscht auch durch das Herz ebenso unerfaßbar, ebenso unerschöpflich. Ebenso furchtbar.
Genügte das nicht?“ (UG, 142)
Brochs Roman wird somit letztlich zu einem literarischen Dokument gegen die wissenschaftlich-mathematische Weltauffassung, zu einer Auseinandersetzung mit der „absoluten Unendlichkeit und ihren Paradoxien“ (HB-Cliver, 122) sowie zu einer Abrechnung mit den in sie gesetzten Erwartungen, die mit den großen Mysterien, mit dem Rausch, auch mit den Sünden des Lebens, nicht mehr zusammenzubringen war.
6. Statistik und Literatur
Wie wissenschaftliche Weltauffassung – knapp vor der Zeit als Broch seine Unbekannte Größe fertig gestellt hat – in ein Romanprojekt Eingang finden konnte, zeigt auch ein anderes Beispiel, jenes von Rudolf Brunngraber. Sein inzwischen auch in der Literaturgeschichtsschreibung rehabilitierter Roman Karl und das XX. Jahrhundert (1932) verdankt sich der radikalen Entmythisierung der Erstfassung durch den Soziologen, Sozialstatistiker und Wiener Kreis-Exponenten Otto Neurathgeb. am 10.12.1882 in Wien - gest. am 22.12.1945 in Oxford; Ökonom, Wissenschaftstheoretiker, Sozialpolitiker, Museumsp... (WSD, 85).
Wie kaum ein anderer Text aus jener Zeit verknüpft er den Lebensgang und die Optionen einer Figur einschließlich der schicksalhaften Schläge mit ökonomischen Daten, Fakten und Gesetzlichkeiten. Die größtmögliche Ordnung – so der Titel des einleitenden Kapitels – ist nicht mehr in einer staatlichen Organisation, in der Vermessung der Ideenlandschaft oder in einer Synthese von rationalem und nichtrationalem Denken aufzuspüren. Sie bildet sich heraus im neuen, revolutionären System der Organisation von Arbeit und Produktion, in der von Frederick W. Taylor entwickelten „wissenschaftlichen Betriebsführung (Scientific Management)“, bekannt alsbald unter den Schlagworten Trustbildung und Taylorismus hin in Richtung „Vollautomatisierung“. (RBK, 16) Wie kaum eine anderer Roman um 1930 versucht er zugleich das programmatische Anliegen Neuraths aufzugreifen, d.h. über wissenschaftliche WeltauffassungAus: Arbeiter-Zeitung, 13.10.1929, S. 17 Titel eines Beitrags, den O. Neurath am 13. Oktober 1929 in der AZ veröffentli... in seiner angewandten Form der kritischen Sozialstatistik einen Beitrag wenn auch nicht zur Revolutionierung der Welt selbst, so doch zu einer Revolutionierung des literarischen Sehens zu entwickeln, was sich u.a. aufgrund der Tätigkeit Brunngrabers als Graphiker im Wirtschafts- und Gesellschaftsmuseum zwischen 1928 und 1934 geradezu aufdrängte.
Der Krieg war aus, der ein Fünftel des Gesamtvermögens der Menschheit verschlungen hatte, nämlich 126 Milliarden Dollar auf Seiten der Entente und 61 Milliarden auf Seiten der Zentralmächte. Für dieses Geld hätte man der Menschheit geben können:
10 000 Gartenstädte mit je 1000 Ein-
Familienhäusern………………………………………….. 100 Milliarden $
100 000 Kinderheime……………………………………… 10 Milliarden $
50 000 Schulen……………………………………………….. 15 Milliarden $
10 000 öffentliche Bibliotheken…………………………2 Milliarden $
500 Universitäten………………………………………….2 Milliarden $
5000 Theater…………………………………………………..5 Milliarden $
[…]
50 000 Stück Großvieh……………………………………..10 Milliarden $
(RBK, 148)
Brunngraber verfährt dabei durchaus innovativ, wenn er seinem Roman einen Protagonisten gibt (Karl Lakner) und diesem einen ungewöhnlichen zweiten, gleichrangigen, ja letztlich mächtigeren zur Seite stellt: das erste Drittel des 20. Jahrhunderts, das in vielfältige Weise in das Leben Karls eingreift. Karl, der die Zusammenhänge nicht zu durchschauen in der Lage ist (auch keine mathematisch-wissenschaftliche Basis Richard Hieck besitzt), wird durch die Erzählerstimme mit den Oberflächenfakten, ausgedrückt in Produktionsziffern und anderen statistischen Daten, auf die in der Wirklichkeit wenig sichtbaren, diese aber konditionierenden Gesetze aufmerksam gemacht. Zugleich wird Karl als – unbedeutender – Bestandteil dieser statistischen Größen (etwa der unfassbaren Zahlenmengen von im Ersten Weltkrieg Verwundeten und Gefallenen oder der Arbeitslosenzahlen seit Ende der 1920er Jahre) in diese anonyme, aber höchst wirksame Welt von Daten und Zahlen integriert. Am eindringlichsten erfolgt dies in den Abschnitten, die den Ersten Weltkrieg behandeln, die Materialschlachten sowie die Kriegskosten und die Weltwirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen auf den Protagonisten im Schlusskapitel Der gepflasterte Weg zur Hölle.
Auf diese Weise wird die traditionelle (literarische) Subjektposition, der Anspruch des Ich auf Weltvermessung und Welterfahrung unterlaufen und kritisch bloßgestellt. Das Ende ist zwar vorhersehbar – ein Scheitern –, in seiner Ausgestaltung jedoch ungewöhnlich: der Freitod als letzter souveräner Akt des Ich wird handlungsmäßig ausgespart und erst am Folgetag – im distanzierten Berichtsstil in Form von Zeitungsmeldungen und der Zeugenaussage einer Prostituierten fassbar.
Dieses Ende kontrastierte die gesellschaftspolitischen, auf (Bewusstseins)Veränderung abzielenden Vorstellungen Neuraths, dem ja für die Konzeption und die sprachliche Gestaltung gleichsam eine verdeckte Co-Autorschaft zuzumessen ist; sie ist vielleicht der Einsicht geschuldet, dass ein auf Rationalität und politische Utopie basierendes Konzept vor der realen Macht der Statistik, die weniger an der Wissenschaft ausgerichtet ist als am ökonomischen Profit, zumal um 1931-32, zur Kapitulation verurteilt war. Der vorletzte Absatz bestätigt geradezu visionär diese gegen den Einzelmenschen gerichtete Perspektive, wenn von der exakten Berechnung des Wertes eines Menschen die Rede ist, die ein amerikanischer Forscher vorgelegt habe: vier Mark, wobei die „Bemessung exakt auf Grund der Verwertbarkeit der in einem Menschen enthaltenen Rohstoffe“ aufbaut: seines Körperfetts (ergibt sieben Stück Seife), seines Eisen (reicht für einen Nagel), des Zuckers (lässt ein halbes Dutzend Faschingskrapfen erwarten), des Kalks, Magnesiums oder des Phosphors, der für „die Köpfe von 2200 Zündhölzern“ ausreiche. (RBK, 289)
Mit dieser fast zynisch anmutenden „desillusionierenden Skepsis“ gilt bzw. galt dieser Roman, insbesondere im Zuge seiner Wiederentdeckung in den späten 1970er Jahren, als radikaler Beitrag zur Neuen Sachlichkeit (Lange, XIII), radikal auch aufgrund seines Montagecharakters. Er war aber nicht minder radikal im Hinblick auf sein subversives Potential der Dekonstruktion von Technikeuphorie durch die Verknüpfung von Technik (als Chiffre des Fortschritts) und den Folgen der Technik mit ihren Devastierungen nicht nur für den Protagonisten Karl sondern für ihn als Stellvertreter einer weithin ohnmächtigen Spezies: des Menschen schlechthin, war er nämlich, so bereits im Eingangskapitel Die sonntägliche Welt, seit seinem Eintritt in die sogenannte Welt (und am Ende dann die seines Todes) nur „einer von den 40 Millionen schreienden Würmern, die damals geboren wurden.“ (RBK, 25) Der statistisch fassbare Vertreter eines Durchschnittsbürgers in der anbrechenden Massengesellschaft führt zugleich die Grenzen der wissenschaftlichen Ratio vor, – in der Verknüpfung mit der literarischen Verfahrensweise ein nach wie vor bedenkenswerter, aus dem Zeithorizont heraus jedenfalls innovativer Ansatz, der in dieser Konsequenz kaum Vergleichbares aufzuweisen hat.16
Siglen
- HB-Cliver: Gwyneth Cliver: Die Unbekannte Größe. In: Michael Kessler, Paul M. Lützeler (Hgg.): Hermann Broch Handbuch. Berlin-Boston: De Gruyter 2016, S. 115-126.
- KW: Hermann Broch. Kommentierte Werkausgabe. Philosophische Schriften 1. Kritik, hg. von Paul Michael Lützeler Bd.10,1, S. 131-145.
- LBB: Paul Michael Lützeler: Hermann Broch. Eine Biographie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1985.
- MHB: Monika Albrecht, Franziska Bomski: Mathematik, Logik, Geometrie, Wahrscheinlichkeitstheorie. In: B. Nübel, N. Ch. Wolf (Hgg.): Robert-Musil-Handbuch. Berlin-Boston: De Gruyter 2016, S. 510-516.
- MM: Robert Musil: Der mathematische Mensch. [April-Juni 1913]. In: Ders.: Gesammelte Werke [GW] 8: Essays und Reden. Hg. von A. Frisé. Reinbek: Rowohlt 21981, S. 1004-1008.
- MOE: Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. = Ders.: Gesammelte Werke in neun Bänden. Hg. von Adolf Frisé. Bd.1-5 (MOE) Reinbek: Rowohlt 1978, 2. verb. Aufl. 1980.
- MT: Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törless. In: Ders.: GW, Bd. 6, S.7-140.
- RBK: Rudolf Brunngraber: Karl und das 20. Jahrhundert. Vorwort Thomas Lange. Nachwort Karl Ziakgeb. am 27.1.1902 in Wien – gest. am 3.11.1987 in Pressbaum; Schriftsteller, Verleger, Volksbildner Aus: Der.... = Quellentexte zur Literatur- und Kulturgeschichte. Bd. 5, hg. von Helmut Kreuzer. Kronberg/Ts: Scriptor 1978.
- WSD: Wendelin Schmidt-Dengler: Statistik und Roman. Über Otto Neurath und Rudolf Brunngraber. In: Ders.: Ohne Nostalgie. Zur österreichischen Literatur der Zwischenkriegszeit. Wien-Köln-Weimar: Böhlau 2002, S. 82-91.
- Vgl. Knut Radbruch: Mathematische Spuren in der Literatur. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1997, S. 141f. ↩
- Vgl. Karl Sigmund: Musil, Perutz, Broch. Mathematik und die Wiener Literaten. In: W. Schmidt-Dengler (Hg.) Fiction in Science – Science in Fiction. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1998, S. 27-39, hier S. 28. ↩
- Vgl. Ders.: Sie nannten sich Der Wiener Kreis. Exaktes Denken am Rand des Untergangs. Wiesbaden: Springer 2015, S. 148-181. Auch die wichtigsten Arbeiten im Schnittfeld von Logik und Mathematik, jene von Hans Hahn, wurden meist zuerst im Verein Ernst Mach vorgestellt. Vgl. dazu: Hans Hahn: Empirismus, Logik, Mathematik. Mit einer Einleitung von Karl Menger. Hg. von Brian McGuiness. Frankfurt/M: Suhrkamp 1988, bes. der den Bd. beschließende Zyklus Logik, Mathematik und Naturerkennen mit seinen Bezugnahmen auf Kant, Mach und Neurath; ebd. S. 141-172. ↩
- Vgl. dazu F. Weltsch: Schöpfende und ordnende Philosophie. In: Prager Tagblatt, 4.11.1931, S. 3-4. ↩
- Vgl. dazu Christoph Hoffmann: ‚Der Dichter am Apparat‘. Medientechnik, Experimentalpsychologie und Texte Robert Musils 1899-1942. München: Fink 1997, S. 64f. (Probandenzeit bei Carl Stumpf an der Univ. Berlin). Ferner dazu Andrea Albrecht/Franziska Bomski: Mathematik, Logik, Geometrie, Wahrscheinlichkeitstheorie. In: B. Nübel, N. Ch. Wolf (Hgg.): Robert Musil-Handbuch. Berlin u.a.: De Gruyter 2016, S.510-516 (mit weiterführenden Literaturangaben). ↩
- Robert Musil: Die Verwirrungen des Zögling Törleß. ↩
- Vgl. Roland Kroemer: Ein endloser Knoten? Robert Musils Die Verwirrungen des Zögling Törless im Spiegel soziologischer, psychoanalytischer und philosophischer Diskurse. München: Fink 2004, bes. S. 62f. und S. 68f. Ferner: Justice Kraus: Musil’s Die Verwirrungen des Zögling Törleß, Cantor’s structures of infinity, and Brower’s mathematical language. In: Scientia Poetica 14(2010), S. 72-103. ↩
- Robert Musil: Der mathematische Mensch. (April-Juni 1913). In: Ders.: Gesammelte Werke 8: Essays und Reden. Hg. von A. Frisé. Reinbek: Rowohlt 21981, S. 1004-1008, hier S. 1004f (künftig Sigle: MM) ↩
- Vgl. P.H. Kucher: Die Auseinandersetzung mit Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes bei Robert Musil und Otto Neurath: Kritik des Idealismus. In: J. u. J. Strutz (Hgg.): Musil-Studien 12. Paderborn: W. Fink 1984, S. 122- 134; ferner Roland Béhar: Jacques Bouvresse und Robert Musil – Gegenwärtigkeit eines Denkens. In: P. Béhar, M.-L. Roth (Hgg.): Musil an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. = Intern. Kolloqium Saarbrücken 2001, Bern-Berlin u.a.: P. Lang 2002, 173-186, ferner Harald Gschwandtner: Ekstatisches Erleben. Neomystische Konstellationen bei Robert Musil. = Musil Studien Bd. 40, München: Fink: 2013, S.137f. ↩
- Vgl. R. Musil: Gesammelte Werke, Bd. 1 (MOE), S. 17. ↩
- Vgl. R. Musil: Gesammelte Werke, Bd. 5 (MOE, Aus dem Nachlaß), S. 1979. ↩
- Vgl. Ernst Mach: Beiträge zur Analyse der Empfindungen (1886, 3. Aufl. 1902). Zit. nach Ders.: Antimetaphysische Bemerkungen, In: G. Wunberg (Hg.): Die Wiener Moderne. Stuttgart: Reclam 1981, S. 137-145, bes. S. 141f. ↩
- R. Musil: MOE, NL. Mappe VII/3; zit. nach: Robert Musil: Klagenfurter Ausgabe. Kommentierte Edition sämtlicher Werke, Briefe und nachgelassener Schriften. Mit Transkriptionen und Faksimiles aller Handschriften. Herausgegeben von Walter Fanta, Klaus Amann und Karl Corino. Klagenfurt: Robert Musil-Institut der Universität Klagenfurt. DVD-Edition 2009, S. 121. ↩
- Hermann Broch. Das Teesdorfer Tagebuch für Ea von Allesch. Hg. von Paul Michael Lützeler. Unter Mitwirkung von H.F. Broch de Rothermann. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995, S.113f. bwz. S. 151. ↩
- Vgl. z.B. die Antwort Brochs auf die Lektüreerfahrung der Gattin seines Verlegers, in der er festhält, dass er sich gefreut habe „daß Sie meine eigene Situation daraus erkannt haben“. Zit. nach LBB, S. 169. ↩
- Vgl. dazu auch Aneta Jachimowicz: Statistik als »Werkzeug des proletarischen Kampfes«? Otto Neuraths statistisches Denken und Rudolf Brunngrabers Individuum-Auffassung in Karl und das 20. Jahrhundert. In: P.H. Kucher (Hg.): Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde. Diskurskonstellationen zwischen Literatur, Theater, Kunst und Musik in Österreich 1918-1938. Göttingen: V&R unipress 2016, S. 269-286, bes. 284f. ↩