Max Winter: Rundfahrt durchs rote Wien (1927)
Max Winter: Rundfahrt durchs rote Wien[1]
Selbst dem, dem oft Gelegenheit gegeben war, in die einzelnen Gemeindebauten zu kommen und alle ihrer Einrichtungen kennenzulernen, selbst dem, der häufig bei Eröffnungen der neuen Bauwerke, die die Gemeinde Wien aufgeführt hat, als Gast anwesend sein konnte, ist es wie eine Offenbarung, so eine Reise durch das rote Wien, wie sie jetzt unsere Bildungsstelle ganz regelmäßig an allen Sonntagen veranstaltet. Es ist ein politischer Anschauungsunterricht ersten Ranges, der da geboten wird, und es ist nur zu bedauern, daß verhältnismäßig nur so wenige diesen so lehrreichen Kursus in praktischer politischer Verwaltung mitmachen können.
Am ersten Aprilsonntag hatte sich eine Ottakringer Sektion — die 21.— zu so einer Fahrt zusammengefunden. Beileibe nicht die ganze Sektion. 300 hatten sich zu der Teilnahme an der Fahrt gemeldet. Es konnten in den vier Autobussen aber nur 180 Teilnehmer verstaut werden. Ueber die Friedensbrücke führte der Weg von Ottakring nach dem Winarsky-Hof[2], dem ersten Ziel. Die breite Brücke und dieser vielverheißende Name! Ein technisch vollkommenes Werk, das eine breite Verbindungsstraße zwischen zwei volkreichen Bezirken darstellt, und dazu ein Name, der wie ein Bekenntnis klingt— beides flog durch die Wagen, die über die Brücke rollten.
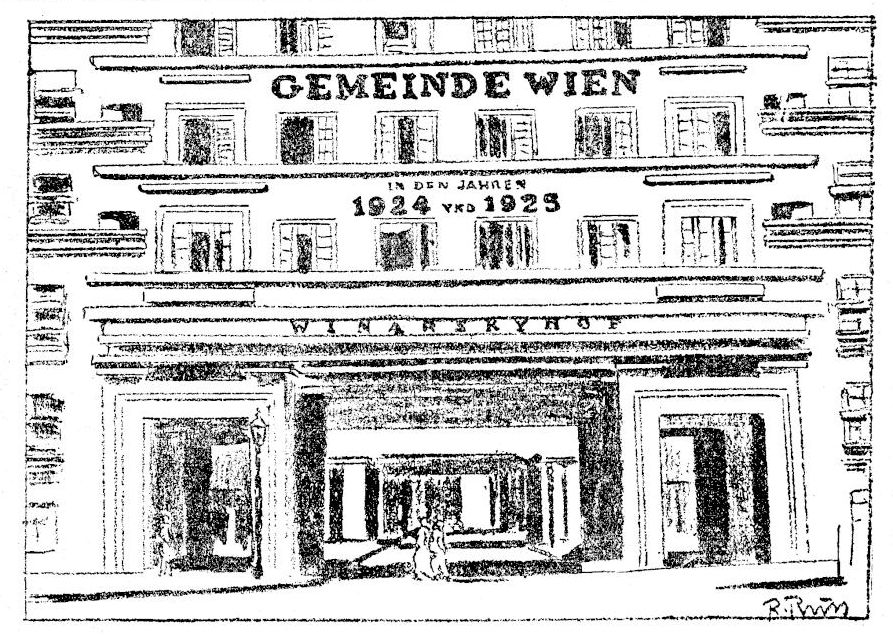
Winarsky-Hof.
Zuerst der Saal. Er beginnt sich gerade zu einer Vorführung der Wahlfilme zu füllen. Erwartungsvolle Spannung auf den Gesichtern und freudiges „Freundschaft!“ zwischen Brigittenau und Ottakring. Einzelne Vertrauensmänner erkennen und begrüßen sich. Und der Führer der Gruppe, Sektionsleiter Wolf, sagt es ihnen, daß sich die Ottakringer einmal den Winarsky-Hof ansehen wollten. Die wichtigsten Hausvertrauensmänner sind zur Stelle und führen die vier Gruppen in die verschiedenen Teile des Hauses. Im eigentlichen Winarsky-Hof fesselt neben dem Saal die große Bücherei die Aufmerksamkeit. Und es entgeht den aufmerksamen Besuchern auch nicht die Kunde der neuen Sittlichkeit, die ihnen mit dieser Bücherei wird. Da sagt irgendwo an der Wand ein handgeschriebenes Plakat: „Jedem stehen die Bücherschätze umsonst offen; wer aber kann, soll freiwillig spenden.“ Auch so eine Bücherei hat Hunger. In Nebenräumen sehen wir, wie immer neue Werke zur Einreihung vorbereitet werden, schauen wir hinter die Kulissen einer großen Arbeiterbücherei. Im ersten Stock der große, schmucke Beratungssaal mit den bequemen Lehnstühlen, mit dem gediegenen großen Tisch in Hufeisenform. Das lachende Antlitz unseres Leopold Winarsky in schönem Rahmen darüber, des ersten sozialdemokratischen Gemeinderates der Brigittenau, dessen Andenken zu Ehren der Hof so benannt wurde. Auch der Entwurf zum Lassalle-Denkmal ist sonst hier an der Wand zu sehen, aber nun muß ihn der Sektionsvertrauensmann erst aus einem Berg von Flugschriftenballen, hinter denen er verborgen ist, hervorholen, um ihn uns zu zeigen. Der Sitzungssaal ist zum Arbeitszimmer geworden, zwanzig Menschen sind den ganzen Sonntag über hier tätig, wahrscheinlich noch viel mehr, in Schichten abwechselnd, die Wahlaufrufe zu kuvertieren und zu versenden. Hochbetrieb! Wir stören nicht länger und gehen weiter. Eine ins Freie mündende Gasse, oder besser ein Straßenhof, nimmt zwei Turn- und Spielplätze auf, auf denen sich die Jugend ungefährdet tummeln kann. Diese „Gasse“ trennt das Hauptgebäude des Winarsky-Hofes von dem zweiten Gebäude, dem Grundsteinblock. Die Spielplätze, über die wir eben schreiten, bekommen dadurch ein besonders schönes Aussehen, daß die beiden Häuserfronten, die auf sie niedersehen, von vielen kleinen Balkons unterbrochen sind. Blumenbalkons, die im Sommer ganz besonders herrlich sein mögen.
Und dann kommen wir in den großen Hof des Grundsteinblocks, der mit seinen strengen Linien jetzt im ersten Vorfrühling den Beschauer fast kalt anspricht, der aber in wenigen Monaten durchzogen sein wird von der Sohle bis zum Dachfirst von rotleuchtenden Linien, denn alle 16 Stiegenhäuser, die in den Hof münden, haben an ihren Fenstern grüne Blumenwannen angebracht, die, sobald nur die erste Sicherheit gegeben ist, daß der Frost den Blüten nicht mehr gefährlich wird, von der Stadtgärtnerei mit leuchtenden Blumen versorgt werden. Und jede Wohnung hat mindestens ein in den Hof mündendes Fenster mit einer solchen Blumenwanne. Im Mai schon setzt der edle Wetteifer zwischen den Bewohnern und der Stadtgärtnerei und unter den einzelnen Bewohnern ein, wer wohl sein Fenster am schönsten hat. Oh, sie sind so schönheitshungrig, diese Proletarier! Man muß ihnen nur Sonne und Luft geben und sie tun dann alles selber dazu, was nötig ist. In einzelnen Ecken des Grundsteinhofes sind amerikanische Reben gepflanzt, sie kriechen an dem Rauhbewurf hinauf. Sie sind gehegt und gepflegt von den Bewohnern. In wenigen Jahren werden sie ihr grünes Sommerkleid über den ganzen Innenhof breiten. In einer Ecke hat ein Straßenbahner mit Hilfe der ganzen Mieter des Hausblocks eine besondere Einrichtung zur Verschönerung geschaffen. Er hat ein kleines Alpinum gebaut mit Wegen, kleinen Almhütten— die Freude der Kinder— und einem wirklichen, sprudelnden, murmelnden Bach. Man braucht nur aufzudrehen und der Bach beginnt zu rinnen und berieselt die Ränder, an denen jetzt schon die Vorfrühlingsblüten wachsen, die im Wienerwald und auf den Höhen weiter draußen zu finden sind. Aber auch einige exotische Primeln, die kinderfaustgroße, kugelrunde violette Blütenballen austreiben, sind schon zu sehen. Anschauungsunterricht für die Kleinen. Sie werden der Natur so nähergebracht. Und die Naturfreunde im Haus kommen selten von einer Wanderung zurück, auf der sie nicht in ihrem Rucksack irgendein Pflänzlein geborgen hätten, das hier, mitten im proletarischen Wohnhof, zu neuem Leben erblühen soll.
Mutter Gemeinde.
In die Mitte des Hofes springt von dem Kindergarten weg im Halbkreis eine Pergola, ein italienischer Laubengang, der zur sommerlichen Zeit vom Grün des wilden Weines umsponnen ist, ein Laufgang zugleich für die Kinder, und in der Mitte im weiten Halbkreis der eigentliche Garten für die Kinder, die dahinter ihre herrlichen Räume haben mit den kleinen Montessori-Möbeln und Tischchen und Stühlchen und kleinen Kasten und dem vielen Spielzeug. Genau so wie es die große italienische Pädagogin wollte, genau so ist es hier zur Wirklichkeit geworden. Während die Mütter oben kochen, spielen unten im Hof, geleitet von kundigen Frauen, ihre Kinder förmlich unter den Augen der Mutter. Ein Blick zum Fenster hinaus, und die Mutter sieht unten ihr Kleines im frohen Kreise der Gleichaltrigen; wohl behütet von den Augen der Mutter Gemeinde.
Da entringen sich den Seelen der Frauen, die mit bei der Besichtigung sind, die ersten Seufzer. Wenn man nur auch so etwas haben könnte!
Im Haus hat sich auch ein Doktor der Krankenkasse niedergelassen. Er öffnet die Tür seiner Wohnung und ladet uns alle ein, wenn wir schon eine Wohnung besichtigen, seine anzusehen. Die Räume sind wohl niedrig, aber die Fenster sind hoch, so daß bis in den letzten Winkel hinein Licht und Sonne scheinen kann. Sie gewinnen etwas Trauliches, etwas Gemütliches, und der Doktor ist glücklich, daß er hier inmitten der Proletarier wohnen kann, und die Vertrauensmänner des Hauses erzählen uns, wie glücklich die Frauen sind, daß sie einen kundigen Mann im Hause wohnen haben, der — und das trifft hier zu— zu jeder Stunde, bei Tag und Nacht, bereit ist, ihnen Hilfe zu leisten. Es ist ein Gefühl der Beruhigung, wenn man weiß, daß der Arzt immer gleich zur Stelle sein kann.
In der Ecke beim Alpinum ist die Badeanlage des Hauses. Sonntag vormittag. Alles vollbesetzt. Der Vorraum voll Wartender. Warme Wannen- und Duschbäder sind vorgesehen. Eine Männerabteilung, eine Frauenabteilung. Welche Wohltat! Welcher kulturelle Aufstieg, daß nun auch der Proletarier immer wieder sein Bad bereitfindet, daß Reinlichkeit kein Vorrecht mehr des Großbürgers ist, der es sich zahlen kann. Wenn die Gemeinde Hausherr ist, so kann auch der Proletarier sein Bad haben, so wie in der Kindergärtnerin auch das Proletarierkind seine Gouvernante haben kann. Warum denn auch nicht! Soll denn wirklich alles ein Vorrecht der Besitzenden sein! Glücklich und zugleich von leisem Neidgefühl beseelt, gehen die Frauen und Männer weiter.

Sechzehn Stiegen hier im Grundsteinhof, zweiunddreißig Stiegen im eigentlichen Winarskv-Hof, insgesamt achtundvierzig, und alle zusammen bilden eine Wohnungsgemeinschaft, die sich einen Mieterausschuß mit drei Untergruppen eingesetzt hat, einen Verwaltungsausschuß, einen Ordnungsausschuß und einen Schlichtungsausschuß. Sie brauchen keinen Administrator, der für alles sorgt, diese Mieter verwalten sich selbst ihr Haus. Der Ordnungsausschuß findet demokratische Mittel, um eine allen genehme Ordnung herbeizuführen, peinlichste Reinlichkeit und Sauberkeit im ganzen Hause, an mehreren Stellen in den Höfen die Colonia-Kübel[3], in die Abfälle hineingeworfen werden können, nirgends liegen Papierln oder Obstschalen herum – und schließlich, wie sie einen Kurator und eine Polizei nicht brauchen, so brauchen sie auch kein Bezirksgericht. Der Schlichtungsausschuß ist das Gericht dieser kleinen Stadt, die sich da in der Stromstraße aufgetan hat, einer in alter Zeit von allen guten Geistern verlassenen Gegend, in die nun das neue Leben Einzug gehalten hat. Aus dem alten Männerheim gegenüber ist ein Heim für alte Männer geworden, ein Versorgungsheim der Stadt Wien, umgeben von einem schönen Garten, und auch das Entbindungsheim der Stadt Wien hat dort seinen Platz gefunden, die jüngste, reichen Segen bringende Mutter- und Frauenanstalt der Gemeinde Wien.
Aus dem Verkehrshindernis wird ein Verkehrsweg.
Mit herzlichem „Freundschaft!“ geht es weiter, hinüber über die große Floridsdorfer Brücke. Wieder ein Werk der roten Gemeinde. Ein Unfertiges hat die bürgerliche Verwaltung hier zurückgelassen, und erst die Tatkraft der roten Gemeinde hat diesen breiten schönen Weg über den Donaustrom geschlagen. Aus dem Verkehrshindernis von gestern ist heute ein Verkehrsweg geworden, der die Mutterstadt mit dem rasch wachsenden Teil jenseits der Donau verbindet. In raschem Fluge geht es hinüber, und ehe noch die Wagen vor dem Schlinger-Hof halten, sehen wir zur Linken wieder ein Werk der Gemeinde Wien, den Paul-Hock-Park, links von der Brünnerstraße, in den der alte Friedhof verwandelt wurde, der einst an dieser Stelle war. Dem tapferen Vorkämpfer für die Freie Schule ein lebendes, unvergängliches Denkmal, der Bevölkerung eine Stätte der Erholung. Zur Rechten dann der Schlinger-Hof, ein neues Wahrzeichen von Floridsdorf. Ein Wahrzeichen der Tatkraft der sozialdemokratischen Gemeinde. Und vor dem Hofe der Markt. Er ist erst vor wenigen Wochen eröffnet worden.
Ist es wirklich gleichgültig, ob private Hausherren Häuser bauen oder die Gemeinde Wien? Nirgends wird einem der Unterschied so bewußt wie hier. Wenn man durch die auch gegen Regen geschützten, das heißt in den Mittelwegen überdachten Marktstände wandert, so fällt einem auf, daß der typische Marktgeruch hier nicht so stark auftritt. Der führende Marktinspektor sagt uns, daß das davon komme, weil die Marktkaufleute ihre Waren in den Kellern im Schlinger-Hof verstauen können. Die Gemeinde baut den Schlinger-Hof, die Gemeinde baut den Markt. Da weiß nun die Linke, was die Rechte tut, das Marktamt und das Wohnungsamt verständigen sich und es wird im Kellergeschoß des Schlinger-Hofes der Raum abgewonnen, um jedem zum Marktstand auch einen lüftbaren und gut gelüfteten Keller zu geben, in den der Marktkaufmann seine Waren mit Hilfe eines Aufzuges schaffen kann. Und an zwei Stellen dieser weiten Kellerräumlichkeiten sind auch große Waschbecken angebracht, in denen das Gemüse gewaschen werden kann. Vom gesundheitlichen und vom wirtschaftlichen Standpunkt bedeutet das einen Fortschritt. Die Ware ist einwandfrei und sie kann länger frisch erhalten werden. Es geht weniger Ware zugrunde. Je weniger Gemüse aber dem Händler zugrunde geht, desto billiger kann das Gemüse dann abgegeben werden. Hätten den Schlinger-Hof Wiener Hausherren gebaut und die Gemeinde hätte von ihnen verlangt, daß sie für die Marktkaufleute Keller einbauen sollen, so wäre dafür eine so hohe Miete begehrt worden, daß das Gemüse nicht verbilligt, sondern wahrscheinlich verteuert worden wäre. Letzten Endes hätten die Marktbudenbesitzer ihre Waren entweder täglich wieder nach Hause schleppen müssen, um sie zu Hause wieder gut aufbewahren zu können, oder sie hätten sie in ihren Buden nachtsüber aufstapeln müssen. Welcher Fortschritt das Heute [!]! Auch Konfiskationsräume sind da und brauchbare Räume für das Marktamt und eine ideale WageEine Wiener Wochenschrift. (1898-1925), Begr. u. Hg. von Rudolf Lothar (1898-1902, urspr. R. Spitzer), ferner von Ernst ... [!], in der irgendeine Manipulation zugunsten oder ungunsten der Parteien darum ausgeschlossen ist, weil die Feststellung des Gewichts völlig auf automatischem Wege vollzogen wird.
Und im Hofe des Riesengebäudes eine der schon berühmt gewordenen Waschküchen der städtischen Wohngebäude, eine Waschküche, wo die Hausfrau in vier Stunden reinigen kann, was eine fünfköpfige Familie in vierzehn Tagen an Wäsche braucht. Neuerdings Bewunderung und Neid derer, die das noch nicht mitbenützen können. Aber auch hier ist schon wieder ein Schritt nach vorwärts gemacht. So wie der Kindergarten nicht nur den Kindern des Hauses zur Verfügung steht, so ist auch diese Waschküche gegen eine ganz bescheidene Miete andern Proletarierfrauen zugänglich, die außerhalb des Hauses wohnen. Die Leistungsfähigkeit der Waschküchen kann dadurch auf das äußerste ausgenützt werden. In einer Viertelstunde ist die Wäsche in den Trockenkulissen trocken und nicht rußig. Ueber jedem Waschtrog gibt es zwei Auslaufhähne für heißes und kaltes Wasser, daneben steht ein Dampfkessel mit Zulauf für heißes Wasser und einem Hebel für den Ablauf des Schmutzwassers. Nirgends braucht die beim Waschen sonst so gequälte Frau schwere Lasten zu heben: Wasser oder nasse Wäsche; immer wieder kommen ihr mechanische Vorrichtungen zu Hilfe. Die elektrische Rolle, die Streudüse zum Wäscheeinspritzen und das elektrische Bügeleisen vervollkommnen die Einrichtung. Da ist es wirklich ein Vergnügen, zu waschen, keine Last mehr, kein Schrecken mehr!
Schlinger-Hof und Bretteldorf.
Und dann der Gegensatz!
Eine rasche Fahrt in das benachbarte Bretteldorf, das auf Ueberschwemmungsgebiet gestellt, von den Kleinbesitzern der Bretterhütten verteidigt wird wie ein Heiligtum, das aber doch eine gesundheitliche Gefahr, nicht nur für die Bewohner des Bretteldorfes, sondern für die ganze Stadt bedeutet. Wir sehen die Kehrichtabfuhr nach dem Coloniasystem, wir sehen, wie oben ein ganzer Wagen gestürzt wird und unten ein Tankwagen seinen Inhalt aufnimmt und wie dieser Tankwagen dann über die neue „Mistg’stetten“ dahinrollt und irgendwo seinen Inhalt entleert, der dann noch sortiert wird von seinem Unternehmer, der da unten den Abfall der Großstadt und proletarische Kraft auswertet. Eine Milliarde Pachtschilling zahlt der Mann für die Erlaubnis, den Abfall der Großstadt auswerten zu dürfen und trotzdem wird er noch ein schwerreicher Mann dabei. Aber die armen Menschen, die diese Arbeit zu leisten haben, wie hausen sie hier! Es ist ein schauriger Einblick, den wir im Vorüberfahren gewinnen, wenn wir in die kleinen Eisenbahnwaggons oder Wagen sehen, die da mitten im Mist, aber ohne Räder, gestellt sind und deren eine Wohnung für ein paar Menschen darstellt. Berge von Glasscherben, Kondensbüchsen sind da und dort aufgestapelt und von anderm Gerümpel. Der Pächter hat einen eigenen Schmelzofen, in dem die Kondensbüchsen und andern Metallgegenstände in Barren gegossen und dann wieder verkauft werden. Ein Großbetrieb, aufgebaut auf die Arbeitskraft wahrer Enterbter. Schaudernd schauen wir in dieses Leben. Und wie Befreiung scheint es uns allen, als der Führer das Zeichen zum Aufbruch gibt, nach der letzten Station, die wir vor uns haben, nach dem Amalienbad in Favoriten[4].
Auf dem Wege dahin begegnen wir in der Rasumofskygasse[5] zwei Damen in Reithosen, die eine mit einer schwarzen Jockeimütze, die andre in schwarzem Schlapphut, beide in schwarzen Fräcken steckend, die eben auf ihren Pferden von dem Morgenritt in den Prater zurückkehren. Ein Blick in die andre Welt. in die Welt derer, die nur ihrer Pflege, nur ihrer Schönheit leben …
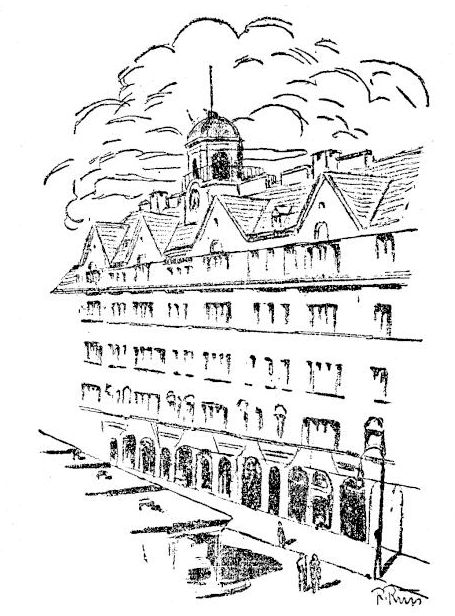
Verbrüderung Ottakring-Favoriten.
Ehe wir die herrlichen Hallen des Amalienbades betreten, das moderne „Tröpferlbad“ und das schöne Dampfbad besichtigen, laden uns noch die Vertrauensmänner eines städtischen Wohnbaues in der Bürgergasse in Favoriten zu kurzem Verweilen ein. Wir treten ein, sie empfangen uns in ihrem noch nicht völlig fertiggestellten Beratungssaal, aber was sich in dieser halben Stunde, die wir dort zubringen, abspielt, das ist ein herzerfreuendes Verbrüderungsfest zwischen den Proletariaten der beiden mächtigsten Wiener Proletarierbezirke, zwischen Favoriten und Ottakring. Im Nu ist aus der Exkursion eine Wählerversammlung geworden, in der ein Exkursionsteilnehmer den Gefühlen aller beredten Ausdruck gibt, den Gefühlen aller für die rote Gemeinde Wien auf der einen Seite, den Gefühlen aller aber auch gegen die Preßhelden der Einheitslistler[6], die begehren, daß alle diese Herrlichkeiten, die da in einem Vormittag geschaut werden konnten, erbaut werden sollen, indem sich die Gemeinde Wien dem internationalen Kapital tributpflichtig macht, ja nicht aus der eigenen Kraft, und die zugleich alles zu schön, alles zu luxuriös, finden. Für die Herren das schön verkachelte hygienische Bad, für das Proletariat das muffige Tröpferlbad, wie es einst war. Das ist die Meinung der Zeitungen der Einheitsfront von dem christlichsozialen Regierungsblatt bis zur „N. Fr. Pr.“.
Und dann geht es wirklich ins Amalienbad. Wir schauen den Zauber, den da die Gemeinde Wien wieder geschaffen hat, für das Proletariat geschaffen hat, damit auch das Proletariat seinem Körper in Gesundheit und Schönheit zugleich dienen könne.
***
Dann geht es wieder nach Hause in die alten Wohnungen und ein Stück Unzufriedenheit in dem Herzen zieht nun mit ein. Dabei aber belebt jeden Einzelnen der große Gedanke: Das, was wir heute geschaut haben, den kleinen Ausschnitt aus dem großen Wirken der sozialdemokratischen Gemeinde der letzten vier Jahre, das ist alles noch ein bescheidener Anfang, es soll noch viel mehr, es soll noch viel Schöneres kommen: 30.000 neue Wohnungen, Spielplätze und Bäder, und für Kinder und Mütter, alles was nötig ist, Krippen, Heime, Kliniken, und für die Kranken und Alten alles, und für die Hausgehilfinnen Heime und dazu Parks und schöne staubfreie Straßen für alle, und vieles andre, alles, alles will die rote Gemeinde leisten, wenn sie getragen ist, von dem Vertrauen des roten Wien. Möge der 24. April ein Tag des Segens werden für diese Stadt, für unser aller geliebtes Wien.
In: Arbeiter-Zeitung, 17. April 1927, S. 19-21.
[1] Der Text erschien eine Woche vor der Nationalrats- sowie der Wiener Gemeinderatswahl 1927.
[2] 1924/25 nach Plänen von Josef Hoffmann, Peter Behrens, Oskar Strnad, Josef Frankgeb. am 15.7.1885 in Baden bei Wien – gest. am 8.1.1967 in Stockholm; Architekt, Designer, Innenraumgestalter F. stam..., Oskar Wlach, Franz Schuster, Margarete Lihotzky und Karl Dirnhuber erbauter Gemeindebau
[3] 1923 in Wien eingeführtes „Umschüttsystem nach dem reichsdeutschen Patent Colonia“. Siehe dazu: http://www.dasrotewien.at/seite/coloniakuebel (Zugriff: 30.12.2022)
[4] Zwischen 1923 und 1926 in Favoriten erbaute Badeanstalt, benannt nach der 1924 verstorbenen Politikerin Amalie Pölzer, die seit 1919 als erste Favoritnerin dem Wiener Gemeinderat angehört hatte. Siehe dazu: http://www.dasrotewien.at/seite/amalienbad (Zugriff: 30.12.2022)
[5] Gasse im dritten Wiener Gemeindebezirk, benannt nach Andrej Fürst Rasumofsky (1752-1836), 1793-1809 russischer Gesandter in Wien. Siehe dazu: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rasumofskygasse (Zugriff: 30.12.2022)
[6] Wahlgemeinschaft der Christlichsozialen Partei, der Großdeutschen Volkspartei sowie österreichischer Nationalsozialisten bei der Nationalrats- sowie Wiener Gemeinderatswahl 1927.

