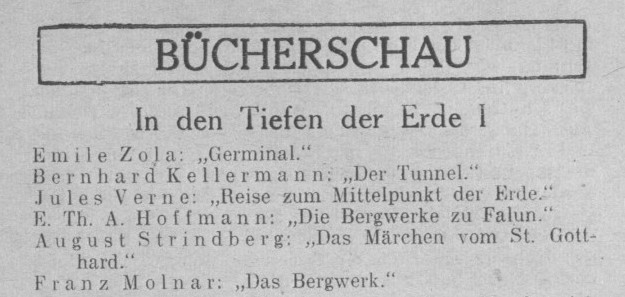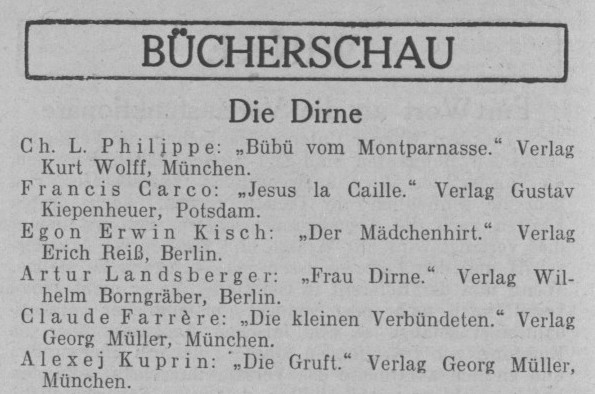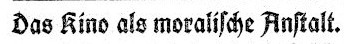Fritz Rosenfeld
Obwohl Verfasser von hunderten Besprechungen literarischer Neuerscheinungen, obwohl Mitbegründer der modernen Filmkritik, der Sprechchor-Dichtungen, Autor von Erzählungen, Romanen und Kinderbüchern hat es Rosenfeld nie geschafft, die Aufmerksamkeit der Literaturgeschichte auf sich zu ziehen. Er galt als parteigebunden, zu links positioniert, als streitbar und war dennoch zuallererst eine nicht wegzudenkende, ins Exil verdrängte Größe der literarisch-kulturellen Debatten der 1920er und frühen 1930er Jahre, – in Augenhöhe mit B. Balázsals Herbert Bauer geb. am 4.8.1884 in Szeged - gest. am 15.7.1949 in Budapest; Drehbuchautor, Filmkritiker und -theoreti..., E. Fischer, L. Lania u.v.a.m., eine Position, die dieses Modul nachzuzeichnen unternimmt.
Von Primus-Heinz Kucher | August 2017
Inhaltsverzeichnis
- Herkunft und Anfänge
- Lebenswelt AZ-/BA-Redaktion – Arbeitswelt des Roten Wien
- Ausbildung der Literatur- und (frühen) Filmkritik
- Aspekte der Film(kultur)kritik
- Vom novellistischen Erzählen über den Sprechchor zum Roman
- Kinder- und Jugendliteratur
- Exil und verweigerte Remigration
1. Herkunft und Anfänge
Als erster von drei Söhnen (Friedrich, Egon, Walter) wurde Fritz Rosenfeldgeb. am 5.12.1902 in Wien – gest. am 27.12.1987 in Sussex (GB); Journalist, Film- und Literaturkritiker Ps.: Frie... bald nach dem erfolgten Umzug nach Wien der im Februar 1902 im damals ungarischen Nágymárton (Mattersburg) nach jüdischem Ritus getrauten Eltern (Vater Moritz war ordinierter Rabbiner) am 5. Dezember desselben Jahres geboren. Friedrich wächst zunächst in der Schmelzgasse im 2. Bezirk auf, anschließend im 3. Bezirk und ab 1915, der Vater ist als Feldrabbiner eingerückt, im 20. Bezirk am Donaukanal. Er besucht das Staatsrealgymnasium II und legt dort im Juli 1921 die Reifeprüfung mit mäßigem Erfolg, ausgenommen das Fach Deutsch, ab. 1922 immatrikuliert er gegen den Wunsch seines Vaters an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien als ordentlicher Hörer in den Fächern Deutsche Philologie und Anglistik. Nachhaltig geprägt hat ihn dabei Eduard Castle, der ihn im Zuge der von ihm angebotenen Übungen der „Freien Gesellschaft für theatergeschichtliche Forschung“ offenbar für das Theater zu begeistern vermochte. Bereits 1922 bot sich Rosenfeld die Gelegenheit, zuerst für die sozialdemokratische BildungsarbeitUntertitel: Blätter für das Bildungswesen der deutschen Sozialdemokratie in Österreich (1909-1913), Blätter für das... und anschließend, ab 1923, für die Kulturredaktion der Arbeiter-ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12.... Beiträge, d.h. Feuilletons, Theater- und, ab 1925, Filmkritiken zu verfassen.1 Gefördert wurde er dabei vom Volksbildner Otto Koeniggeb. am 12.5.1881 in Wien – gest. am 15.9.1955 in Klosterneuburg; Redakteur, Kritiker, Volksbildner K. studierte Germ..., aber auch von David J. Bachgeb. am 13.8.1874 in Lemberg (Lviv) – gest. am 30.1. 1947 in London; Kulturfunktionär, Journalist, Kritiker Aus:.... Im ersten Jahr seiner AZ-Präsenz konzentrierte sich R. stärker auf literarische Formen wie z.B. die Novelle und feuilletonistische Kurztexte. So erschien im August 1923 die novellistische Erzählung Die Verfluchten in sieben Folgen, dem als Debüttext am 24.7.1923 Der alte Herr vorangegangen war und am 25.12.1923 sein erster, der Kino-Realität gewidmete Beitrag, das Feuilleton Vorstadtkino folgen sollte. Zwischen Oktober und Dezember 1924 veröffentlichte Rosenfeld schließlich seinen ersten Roman Johanna als Fortsetzungsroman in der Salzburger Wacht und erhielt auch die Möglichkeit, für die Programmzeitschrift Der KampfGegründet im Okt. 1907, Wien bis H. 12/1933; ab H. 1/1934 vereinigt mit der Zs. Tribüne bis Mai 1938, Brünn/Brno; dan... Beiträge zu verfassen, etwa für das Juliheft 1924 einen über Ernst Toller.
Somit vollzog sich innerhalb eines guten Jahres Rosenfelds fulminant wirkendes Entrée bzw. seine Aufnahme in die erste Riege des literarischen Feuilletons, der Literatur- Film- und Kulturkritik sozialdemokratischer Zeitungen und Zeitschriften, eine Präsenz, die bis 1933-34 ungebrochen anhielt und auch sozialdemokratische Organe in Deutschland, der Schweiz und Tschechoslowakei einschloss (Mayr/Omasta,71).
2. Lebenswelt AZ-/BA-Redaktion – Arbeitswelt des Roten Wien
War die Kulturredaktion der Arbeiter-Zeitung mit Bach und Koenig bereits prominent besetzt und es daher nicht leicht, sich dort einen Platz zu erschreiben, so gestaltete sich dies in der Bildungsarbeit [BA], der Monatszeitschrift der Sozialistischen Bildungszentrale, die, primär an ihre Funktionäre gerichtet, in der öffentlichen Wahrnehmung weniger präsent war, offenbar etwas leichter. Allerdings galt es in der BA, zu aktuellen Debatten Positionen zu entwickeln, die zwar kritische sein konnten, zugleich aber im Rahmen der kulturpolitischen Vorgaben zu bleiben hatten. Darüber hinaus waren (eher ungewohnte) Genres mit zu bedienen, z.B. jenes der ›Vortragsanleitung‹ oder der Sammelbesprechung in der Rubrik ›Bücherschau‹, die von Rosenfeld zu einer von ihm im Lauf der 1920er Jahre mitgestalteten Domäne werden wird. Zunächst verstrickte er sich jedoch in eine Debatte über die Ausrichtung des Literatur-Unterrichts für ArbeiterInnen im Rahmen sozialdemokratischer Bildungseinrichtungen. Methodisch an zeitgenössischen Ideen des Arbeitsunterrichts (dialogisches Lernen, begleitende Reflexion, Anbindung an den Lebenskontext bzw. an proletarische Erlebnispotentiale) ausgerichtet, konzentrierte er sich auf die Gegenwart und ihre literarischen Leistungen – „mehr Georg Kaiser, weniger Friedrich Schiller“ – und markierte zudem Distanz zu jeglicher „Betonung des nationalen Elements“:
Was national ist, muß fort. Was danach angetan ist, zwischen Mensch und Mensch Grenzen zu legen, ist reaktionär und darf in einer Proletarierschule keinen Platz finden […] Echte Kunst war von jeher übernational. (BA, 1922,43)
Mit dem Zusatz „Anstelle des Nationalkampfes, der Chauvinistengeschreibsel predigt, trete der Klassenkampf“ akzentuierte er die Abwendung von einer auch in der österreichischen Sozialdemokratie mitunter spürbaren (deutsch)nationalkulturellen Ausrichtung zugunsten der ihm wichtigeren Perspektive, wonach bei der Auswahl der Texte/Autoren „revolutionäre Dichtung in jedem Sinne ins Auge gefaßt“ werden müsse (Ebd.). Das progressive bürgerliche Erbe, d.h. Lessing, Schiller, Heine, Tolstoi u.a. könne dabei ebenso Berücksichtigung finden wie ein ihm notwendig erscheinender Brückenschlag in die Gegenwart, wofür Autoren wie Upton Sinclair und Ernst Toller besonders geeignet wären, um die eigentlich wichtige Perspektive in den Blick zu bekommen, d.h. die „Erlebnismöglichkeiten des Proletariers“ (Ebd.,44) anzusprechen.2 In dieser Kontextualisierung gewinnen auch die Klassiker von Dante über Goethe, Kleist, Hebbel, Molière, ja selbst Novalis ihren Raum neben der heroischen Traditionslinie von Schiller über Büchner, Ibsen bis zu Wedekind, Kaiser, Sinclair und Toller zurück.
Freilich war diese Positionierung in der Redaktion der BA nicht unumstritten (Kucher, 2017, 85f.). Otto Koenig sah sich z.B. veranlasst, auf Rosenfeld zu reagieren und ihn ein wenig lehrerhaft in Schranken zu weisen: „Vor allem verkennt Rosenfeld die Aufgaben eines Arbeiter-Literatur-Unterrichts“ (Koenig, 9/1922, 65). Besonders störte Koenig die Vorstellung, dass Rosenfelds Arbeiter-Literatur-Konzept vom Erlebnispotenzial ausgehend eine „sozusagen objektive Grundlage der Kunstbetrachtung zu schaffen“ vorsah, ohne Dichtung als „ideologische Überbau“- Formation prioritär einzustufen, wie es das Basis-Überbau-Modell vorsehe, welche auch die damit verknüpfte Perspektive „steter gesetzmäßiger Entwicklung“ ausmache (Ebd.). Ein genauer Vergleich der Argumentation in beiden Beiträgen lässt deutlich werden, dass hier Koenig den jungen Rosenfeld mitunter verengt wahrnimmt. Denn mit dem Entwicklungsaspekt wird auch der zweite, massive Punkt des Einwands ins Spiel gebracht: das Kausalitätsprinzip, das darauf abziele, gesetzmäßige Entwicklung als zentrales Prinzip der materialistischen Geschichtsauffassung (wie Koenig nachsetzt) nicht aus dem Blick zu verlieren sei. Man müsse nämlich stets „vom Vergangenen ausgehe[n] zur Gegenwart und nicht umgekehrt“, anderes führe nur „zu lächerlicher Überschätzung der Gegenwart und erfahrungsgemäß nicht zu dem inneren Prozeß, den wir ‚Bildung‘ nennen“ (Ebd.) Es ginge ferner nicht an, „lieber fremde Dichter der Gegenwart als ältere Dichtungen der eigenen Entwicklung“ zu behandeln (Ebd.) und als „Sozialist“ erklärte er, Koenig, was Rosenfeld ja nicht grundsätzlich in Frage stellte, sondern nur anders gewichtete, es gäbe ohnehin „keine anderen als zeitgebundenen Werke“ und leitet daraus einen weiteren Seitenhieb ab: „Echte Kunst war von jeher national! Nicht übernational!“ (Ebd.) Schließlich störte Koenig die Aufwertung Kaisers und die Abwertung Schillers massiv:
Wie kann man Schiller, mit dem ein halbes Jahr im Arbeiterunterricht zu beschäftigen freilich etwas wenig wäre, Georg Kaiser gegenüberstellen, von dessen staunenswertem Talent die gewiegtesten und vorurteilsfreiesten Kenner heute noch nicht wissen, ob es nicht die Begabung eines Sudermann des Expressionismus ist! (Ebd.)
Von dieser tendenziell untergriffigen Kritik ließ sich Rosenfeld jedoch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Zu wichtig war ihm die Möglichkeit, im Literatur- und Kulturbetrieb des ›Roten Wien‹ Fuß fassen und sich als Teil der dynamischen, am gesellschaftlichen wie kulturellen Umbau engagierten Sozialdemokratischen Partei begreifen zu können, an einem Umbau, der trotz der schwierigen ökonomischen Krise jener Jahre, d.h. der Hochphase der Nachkriegs-Inflation und Spekulation, unter der Oberfläche sich vorzubereiten begann. In einer Reihe von z.T. ausgreifenden Beiträgen präsentierte er noch im selben Jahr 1922 sowie in den beiden nachfolgenden in der Rubrik Bücherschau eindrucksvoll seine Überlegungen und Kenntnisse der nationalen wie der internationalen Literaturlandschaft und festigte damit seine Position im Mitarbeiterkreis. Im Besonderen wird dies in einer Vorstellung und kritischen Besprechung von insgesamt dreißig Texten in einem fünfteiligen Zyklus zum Thema In den Tiefen der Erde sichtbar: Texte, die durch das Rahmenthema Arbeit und Bergwerk sowie durch die literarästhetische Frage der Angemessenheit der Darstellung, des Gelingens künstlerischer Durchdringung des Stoffes und dichterischer Gestaltung verbunden sind. Damit beginnt auch schon sehr früh
3. Die Ausbildung der Literatur- und frühen Filmkritik
| In den Tiefen I | In den Tiefen II | In den Tiefen III | In den Tiefen IV | In den Tiefen V |
| BA Nr. 1-2/1922 | BA Nr. 3-4/1922 | BA Nr. 7-8/1922 | BA Nr. 9/1922 | BA Nr. 1/1923 |
| E. Zola: Germinal B. Kellermann: Der Tunnel E. T. A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun A. Strindberg: Das Märchen vom St. Gotthard F. Molnar: Das Bergwerk | L. Dill: Virago M. Schmidt: Die Knappenliesl vom Rauscheberg E. delle Grazie: Schlagende Wetter A. Achleitner: Tugendloses Gestein L. Ganghofer: Der Mann im Salz P. Grabein: Aus dem Reich der Diamanten/ Die Huren der Erde L. Brinkmann: Die Erweckung der Maria Carmen U. Sinclair: König Kohle C. Lemonnier: Der eiserne Moloch | N. Lambrecht: Das Land der Nacht M. Jokai: Schwarze Diamanten F. Adamus: Familie Wawroch A. Perfall: Das verlorene Paradies E. Werner: Glück auf | J. Falkbergetgeb. als Johan Petter Lillebakken am 30.9.1879 in Røros/Norwegen – gest. am 5.4.1967 ebd., Schriftsteller F. begann ...: In der äußerten Finsternis G. Janson: Im Dunkel W.L. Andree: Wetterleuchten L. Brinkmann: Aus meiner Bergwerkszeit I, II F. Herold: Errungen | F. Jung: Die Eroberung der Maschinen H. Zur Mühlen: Licht C. Espina: Das Metall der Toten H. Kaltnekergeb. am 2.2.1895 in Temesvár, Österreich-Ungarn - gest. am 29.9.1919 in Gutenstein, Niederösterreich; Lyriker, Dramat...: Das Bergwerk |
Ausgehend von der Formel ›Kampf ums Dasein‹, zugleich verstanden als eine gegen die „Tücke der Brotspenderin Erde‹, setzt Rosenfeld den „Anklageroman“ Germinal von Emile Zola an den Beginn seiner Tour d’horizont. Zwar teilt er einige der (spezifisch deutschen) Vorbehalte gegen den Zola’schen Naturalismus, z.B. die meist auf Schlagworte reduzierten Einwände bezüglich Tendenz, Forcierung des Hässlichen, des Triebhaften, Verlust des allgemein Menschlichen, was u.a. „dichterische Unzulänglichkeit“ zur Folge haben könne. Doch er kommt nicht umhin, anzuerkennen, dass Germinal Blicke „in Abgrundtiefen der leidenden Menschenseele“ gewähre, womit ein Abrücken von kulturpolitisch motivierten Vorkriegsperspektiven und früher sozialdemokratischer Leseerziehung angezeigt wird. Als ebenfalls nicht unproblematisch, jedoch überzeugender als Zola, wird in der zweiten Textgruppe Camille Lemonnier und sein dem belgischen Naturalismus zugerechneter Roman Der eiserne Moloch (1910, Orig.: Happe-chair, 1886) eingestuft:
Uns sagt Lemonnier nicht deshalb mehr als Zola, weil er – wie Schlaf [der ein Nachwort zur deutschen Ausgabe verfasst hatte, Anm. d. Verf.] behauptet – naturalistischer ist, sondern weil er über die Grenze des abgeschilderten Flecks Erde ins Allgemeinmenschliche, mit monumentaler Kraft rasende Leidenschaften gestaltet, weil er Probleme, die zeitlos sind, allerdings in die Enge der Realität gebannt, zu formen versucht“ (BA,3-4/1922)
Unter den ersten fünf Texten nimmt Bernhard Kellermanns (1897-1951, mehr hier) im zeitgenössischen Horizont sehr erfolgreicher, technikeuphorischer wie sozialkritischer Roman Der Tunnel (1913) die Spitzenposition ein. Das „imposante Phantasiegemälde“ einer unterirdischen Verbindung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten kommt Rosenfelds Erwartungen offenbar am nächsten. Es überzeuge nicht nur durch den Stellenwert der Technik, sondern durch Konfliktlagen, die sich im Zuge der Realisierung dieses Projekts herauskristallisieren, insbesondere des, so Rosenfeld, Kampfes gegen „die Aasgeier des Menschenmarktes, der kapitalistischen Gesellschaft“, der eine wichtige Perspektive anzeige.
Franz Molnars Bergwerk-Roman lasse dagegen „jedes ernsthafte Erfassen der Probleme des Bergarbeiterlebens vermissen“, setze reißerisch auf Liebeshändel, weshalb „arbeitende, ernste Menschen“ vor ihm zu warnen seien. Künstlerische Mängel, begleitet von solchen der sozialen Gesinnung, würden auch die Texte der dritten Gruppe (Adamus, Jokai, Lambrecht, Perfall, Werner) negativ auszeichnen, womit am Ende neben den bereits erwähnten (Kellermann, Lemonnier) nur noch die Romane von Espina, Falkberget, Jung, Sinclair, Zur Mühlen sowie Kaltnekers Drama Beachtung verdienten. Johan Falkbergets In der äußersten Finsternis (1912) stellte dabei für Rosenfeld den „besten Bergarbeiterroman der europäischen Literatur“ dar, gelinge es ihm nämlich, „das beglückende und grausame Leben“ mit „schlichtesten Mitteln“ , einer „schmerzlichen, wuchtigen Formung“, aber auch „verklärt vom Licht der Hoffnung“ zu gestalten. Im Vergleich dazu tritt Herymnia Zur Mühlens früher Roman zwar in „erstaunlich dichterischer Kraft“ auf, sei aber letztlich nicht ausgereift, während Fritz Kaltnekers Drama Das Bergwerk (1918), zugleich die 1000. Wiener Arbeitervorstellung im RaimundtheaterDie Gründung des Raimundtheaters ging auf eine Initative von rund 500 Wiener Bürgern zurück, die sich 1890 zum „Wie..., einerseits sehr an Toller und Sinclair angelehnt wirke, zugleich aber auch einen „heiße[n] Atem tiefer Menschlichkeit“ verströme.
Im letzten Heft des Jahrgangs 1922 setzte Rosenfeld mit einer Sammelbesprechung über Russische Erzähler nach. Mit einer Ausnahme waren dies zwar Vorkriegstexte bürgerlicher russischer Autoren, aber zugleich solche, die durch psychologische Grenzfälle und Degenerationsprozesse Aspekte eines „durch und durch verfaulten russischen Bürgertums“ zur Sprache brächten und somit implizit gesellschaftliche Problemlagen darlegen. Fjodor Sologubs Der kleine Dämon wird z.B. Heinrich Manns Professor Unrat zur Seite gestellt; Leonid Andrejews Geschichte von den sieben Gehenkten ebenso wie Michail Kusmins Der zärtliche Josef zeigen aufgrund ihrer Form aufsprengenden Narration und ihrer Fokussierung auf das Innenleben Perspektiven über den Realismus hinaus an, wobei die „Gesellschaft […] Triebfeder und zugleich Resonanzboden des Schicksals des einzelnen [ist]“ (BA, 12/1922,94).
Weitere, meist mehrere Werke umfassende Besprechungen bezogen sich 1923 einerseits auf Schlüsselfiguren proletarisch-sozialer Literatur, andererseits auf Themen, die klassische Sujets wie z.B. jenes der Utopie mit zeitgenössischen Realitäts- und Befundlagen zu konfrontieren suchten oder Außenseiterexistenzen ins Zentrum rückten. Eröffnet wird dieses Spektrum mit einer Werkübersicht zu Knut Hamsun, beginnend beim Roman Hunger, der „grandiose Auftakt eines Dichterlebens bis hin zu Weiber am Brunnen“ (BA,1/1923,7-8 bzw. 2/3/1923, 21-22).
Rosenfeld verfasste ferner Vortragsanleitungen gemäß den Vorgaben sozialdemokratischer Schulungsarbeit, u.a. eine zu Alfons Petzold, den er als „Typus des österreichischen Proletariers“ skizzierte, d.h. „allen Extremen abgeneigt“ und daher geeignet, „Sprachrohr der Arbeiterschaft“ zu sein (BA, 1/1923,2). Die Gliederung einer solchen Vortragsanleitung ist erwartungsgemäß konventionell: Leben – Werk, anschließend Ausdifferenzierung in Prosa und Lyrik mit einer empfehlenden Liste von Gedichten/Texten für die Rezitation.
„Je trister das Leben ist, um so heller lodern die Sehnsüchte, je grausamer der Alltag, um so allgemeiner, leidenschaftlicher die Flucht in eine selbstgeschaffene, bessere Welt…“ (BA,4/1923,31) – unter dieser Leitperspektive setzt sich Rosenfeld in zwei zwar unterschiedlich betitelten, aber thematisch verwandten ›Bücherschau‹-Beiträgen mit Texten auseinander, die mehr oder weniger explizit sogenannte Zukunftsbilder entwerfen, die unterschiedliche Realitätsanbindungen, phantastische Züge, gesellschaftspolitische Referenzen und Visionen aufweisen. Der erste Beitrag mit dem Untertitel ›Traumland‹ befasst sich mit vier Büchern, die sowohl großdimensionierte utopische Projekte als auch Aussteigervisionen und Dystopien zur Diskussion stellen. Rosenfeld beginnt mit Egmont Colerus‘ Roman Der dritte Weg (1921), den dieser bereits 1917-18 verfasst hatte, und der vor dem Hintergrund der Kriegs- und Hungererfahrung sowie mit Blick auf Verhinderung eines neuerlichen Krieges den „gemeinsamen Kampf aller Nationen gegen die unbelebte Natur“, d.h. die Nutzbarmachung brachliegender Flächen zur Sicherung der Lebensgrundlage, in den Mittelpunkt rückt. Verbunden mit dieser übernationalen Solidarisierung, die zu reaktionären völkischen Gegenbewegungen führt, ist zudem die „Idee sozialer Gleichheit“, auch in der Kunst, welche „die Ketten des Kapitals“ zu zerreißen imstande sei. (BA,4/1923,31). „Vernünftige Gemeinschaft“ „Glück“ und „Gerechtigkeit“ lauten die Schlüsselworte für Max Brods Das große Wagnis (1918), doch der Roman, der in manchem an Kubins Die andere Seite erinnert, führt in eine Gemeinschaft, die einerseits von despotischen Allüren gekennzeichnet ist, andererseits sich „als Tummelplatz wildester Leidenschaften, als Nährboden glühendster Sünde entpuppt“ (Ebd.,32). Auch der auf Traumaufzeichnungen und Visionen gründende Aussteiger-Roman Reich ohne Raum (1919) von Bruno Goetz findet, obgleich dem Dichter schwer zu folgen sei, aufgrund seiner „Sehnsucht nach dem Unendlichen […] nach wirtschaftlicher Gleichheit, nach Abschaffung der Sklaverei, in welcher Form sie immer auftritt“ Rosenfelds Interesse (Ebd., 32). Den Abschluss bildet eine Auseinandersetzung mit Aage Madelungs Zirkus Mensch (1918), der als „Satire auf den sozialistischen Gemeinschaftsstaat“ gefasst wird, als eine Ansammlung bedrohlicher Visionen, die von konservativer Seite in eine – so der Vorwurf – auf „wüster Gleichmacherei“ aufgebaute sozial(istisch)e Utopie projiziert werde (Ebd., 32)
Dieser Bücherschau folgt eine zu Herbert G. Wells in Form einer Besprechung von insgesamt acht auf Deutsch vorliegender Texte, die ebenfalls als „Zukunftsbilder“ firmieren. Einleitend nimmt Rosenfeld zunächst eine Abgrenzung zum zeitgenössischen Science fiction-Autor par excellence, vor, zu Jules Vernes, zu dem er nur eine „äußerliche“ Verwandtschaft gelten lässt. Im Vergleich zu Wells attestiert er ihm eine „Dürftigkeit künstlerischer Gestaltung“ sowie eine Beschränkung auf „technisch geschultes Ahnungsvermögen“ (BAS,6/1923,51). Die meist zwischen 1900 und 1910 vorgelegten, vor dem Ersten Weltkrieg schon ins Deutsche übersetzten und nach 1918 z.T. neu aufgelegten Romane hätten dagegen „viel größeren geistigen Tiefgang“, weil sie vom jeweiligen (wissenschaftlichen) Romanstoff aus […] „die Brücke [schlagen]“ zu gesamtgesellschaftlichen Aspekten einschließlich ihrer kritischen Kommentierung. Herausgestrichen werden dabei die Romane Time Machine (1895)/Die Zeitmaschine (1904) sowie The War in the Air (1908)/Luftkrieg (1909). Während die Zeitmaschine die Leser in das Jahr 802.701 versetzt und neben Abenteuer-Charakter „an Schrecklichkeit nichts zu wünschen“ übrig lässt (Ebd., 51), insofern als die Menschheit in zwei Hälften geteilt erscheint, nämlich in eine sonnige Oberfläche des Genusses für Wenige und in verstoßene Arbeitssklaven, die in dunklen Tiefen arbeiten und „ihren glücklicheren Zeitgenossen im Licht [….] das Leben so angenehm als möglich“ machen, jedoch auch zum Alptraum, weil sie sich zugleich von deren Fleisch nähren, zeichnet Luftkrieg die bedrückende Vision einer Synthese aus technischem Fortschritt und Steigerung der Vernichtungspotenziale in ungeheure Luftflotten mit devastierenden Verwüstungen für die gesamte Kulturlandschaft, – unverkennbar kritische Anspielungen auf den zeitgenössischen Rüstungswettlauf und die „durch jahrelang geschürten Völkerhaß“ (Ebd. 51) angestaute Feindschaften. Ähnlich auch die Einschätzung des Romans When the Sleeper Awakes (1898)/Wenn der Schläfer erwacht (1906), in der ein Ausflug in eine zukünftige, extrem polarisierte Welt unternommen wird. Polarisiert, weil „mit der grandiosen Entwicklung der Technik“ auch „die Vergrößerung der sozialen Gegensätze, der Korruption, der Versklavung getreulich Schritt gehalten“ habe (Ebd., 52). Klingt durch manche Wertungen auch ein ideologisch erkennbares Grundmuster durch, d.h. das der kapitalistischen Ausbeutung und Entfremdung, so bemüht sich Rosenfeld doch stets um eine Würdigung der künstlerischen und formalen Aspekte dieser Romane, wie dies in den Bemerkungen zum letzten der behandelten Texte, dem Traktat ähnlichen Buch A Modern Utopia (1905)/ Jenseits des Sirius (1911) hervorgeht (Ebd., 52). Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Themenfeld ›Die Dirne‹ (BA 7/1923, 74-76) . Für dieses werden neben französischen Autoren auch E.E. Kisch mit seinem Mädchenhirt und der damals vieldiskutierte Alexej [recte: Aleksandr] Kuprin mit Jama (dt. 1923, Die Gruft) aufgeboten. Erstmals wird Rosenfeld auch in der Programmzeitschrift „Der Kampf“ fassbar und zwar mit einem Werkporträt des dänischen Schriftsteller Martin Andersen Nexögeb. als Martin Andersen am 26.6.1869 in Christianshavn, Kopenhagen - gest. am 1.6.1954 in Dresden; Lehrer, Journalist,&..., insbesondere seinen 1921 im Malik-VerlagDurch den Erwerb einer Schülerzeitschrift gelang Wieland Herzfelde und seinem Bruder John Heartfield (d.i. Helmut Herzf... erschienenen revolutionären Novellen Die Passagiere der leeren Plätze und dem autobiographisch eingefärbten Roman Pelle, der Eroberer, in dem „die Entwicklung des klassenbewußten Proletariers“ mit „dem eigenen Schicksal des Dichters zu einem Ganzen verschmolzen wird“ (K 11/1923,381). Diese frenetische wie beeindruckende Arbeit als Rezensent und Porträtist zentraler Referenzautoren für eine weltoffene, das humanistisch-bürgerliche Erbe mitreflektierende proletarische Lese-Bildung setzte sich auch 1924 fort, u.a. in zwei großen Beiträgen zu Romain Rolland bzw. zu Ernst Toller.
Der Toller-Essay verdient v.a. deshalb Beachtung, weil in ihm Rosenfeld einerseits die Wandlung des bürgerlichen Rebellen hin zum revolutionären Sozialisten „aus Erkenntnis“ bzw. zum Räterepublikaner im offenen Kontrast zum Gewaltprinzip der Revolution nachzeichnet, die seit dem Vorliegen von Masse Mensch (1921) und Die Maschinenstürmer (1922, im E.P.Tal-Verlag!) zu Kontroversen und Verwerfungen, u.a. im Berliner Zentralorgan der KPD, geführt haben. Andererseits setzt er sich auch mit den Ansprüchen an das moderne Drama und die ihm gemäße Konfliktausgestaltung und Figurenzeichnung – der Held „nicht so sehr Kämpfer wie Schauplatz des Kampfes“ (K,7/1924,295) – einlässlich auseinander.
Rosenfeld etabliert sich mit diesem Spektrum von Referenzautoren sowie Themen, die von Arbeitswelten über Phantastik, soziale und technische Utopien sowie gesellschaftlich gebrandmarkte Außenseitersphären hin zu jenen der Verknüpfung von revolutionären und Gewalt ablehnenden Veränderungsansprüchen reichen, seit 1923-24, d.h. noch vor Ernst Fischergeb. am 3.7.1899 in Komotau/Böhmen – gest. am 31.7.1972 in Deutschfeistritz; Schriftsteller, Politiker (KPÖ) Ps.: F.... und parallel zu Leo Laniaeigentl. Hermann Lazar, geb. am 13.8.1896 in Charkow - gest. am 9.11. 1961 in München; Journalist, Schriftsteller ... zu einer wichtigen Instanz im sozialdemokratischen Literaturbetrieb und verstand sich dabei der austromarxistischen Bildungsidee verpflichtet. Deutlich sichtbar wird dies auch in seinem Feuilleton- und Dienstboten-Roman Johanna (1924), erschienen in der sozialdemokratischen „Salzburger Wacht“, in seiner Mitwirkung an den Kurzbesprechungen der „Bildungsarbeit“ ab 1925 (anfangs etwa dreißig, ab 1928-29 bis zu einhundert/Jahr) sowie an seiner Teilnahme an der Sprechchor-Debatte seit 1925 (Doll,2016,80f.).3 Unter den besprochenen Büchern und Autoren finden sich auch 1925 neben bereits bekannten Themen und Interessen wie z.B. zur skandinavischen Literatur (BA,7/8/1925, 58-59) oder zur Außenseiterthematik (anhand der Buchreihe ›Außenseiter der Gesellschaft‹ im Schmiede- Verlag) neue Akzente: Besprechungen von Frauenromanen von Karin Michaelis, die für Rosenfeld eine Perspektivenverlagerung und zwar weg von klassischen Eheromanen hin zu „Kampfromane[n]“ indizierten (AZ, 15.6.1925,4), ein Lyrik-Akzent (mit Büchern von Hugo Salus, Arnold Ulitz und Hanns Johst [!]) sowie der in den Folgejahren an Gewicht gewinnende Amerika-Schwerpunkt.
Rosenfelds Aufmerksamkeit ist nahezu nichts entgangen. Davon zeugt gerade die erwähnte Besprechung der Reihe Außenseiter der Gesellschaft, deren ersten vier Bände, verknüpft mit Überlegungen über das „Anwachsen der Kriminalität nach dem Krieg, bedingt durch die politische Glutatmosphäre einerseits und die Zerrüttung des privaten Lebens andererseits“, bereits „grundverschiedene Typen […] moderner Kriminalfälle vorstellen: Eduard Trautners Mord am Polizeiagenten Blau, Ernst Weiß‘ Fall Wukobranovics, E.E. Kischs Fall des Generalstabchefs Redl sowie Alfred Döblins als „musterhaft“ eingeschätzter Text Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. (SW,17.8.1925,7).
Im darauffolgenden Jahr 1926 nimmt einerseits die seit 1923-24 entwickelte Film-Kritik sowohl mit grundlegenden filmästhetischen wie filmsoziologischen Beiträgen als auch Einzelbesprechungen zu, andererseits konzentriert sich seine Literaturkritik auf moderne Klassiker (z.B. über Zolas Zyklus Die Rougon-Macquart; BA 11/1926,200-203) sowie auf Einzelbesprechungen wobei sein Fazit für die zeitgenössische Jahresproduktion 1926 von wenigen Ausnahmen abgesehen – „arm an literarisch wertvollen Neuerscheinungen“ – deutlich negativ ausfällt. Zu den Ausnahmen zählt Rosenfeld Stefan Zweigs Verwirrung der Gefühle sowie Arthur Schnitzlers Fräulein Else sowie – überraschend – Egmont Colerus‘ neuaufgelegten Sodom-Roman (BA, 12/1926,225-227). Daneben betätigte er sich als Theaterkritiker, veröffentlichte vorwiegend in der „Salzburger Wacht“, darunter auch eine Reihe feuilletonistischer Kurzerzählungen wie Die Kette (Link) und beteiligte sich an der Sprechchor-Diskussion, die in mehreren sozialdemokratischen Organen (Bildungsarbeit, Arbeiterwille, Der Kampf) geführt wurde. Letzteren definiert er im Kampf als „neue Kunst, als die Kunst der proletarischen Bewegung“ (K, 1926, 85). Zwar müsse der SprechchorUnter dem Eindruck der Aufführung des Requiem der erschossenen Brüder im Rahmen der Republikfeier 1923 in Linz sowie d... als Kunst der Masse und „proletarische Bekenntniskunst“, um revolutionär zu sein, „erst seine eigene Sprache finden“ (Ebd., 86). Tollers Der TagTageszeitung 1922-1938 Materialien und Quellen: Eintrag über Redaktionsverantwortliche bei OeAW: https://www.oeaw.ac.at... des Proletariats sei zwar richtungsweisend gewesen, indem die klagende Masse durch eine Führer-Stimme von außen her aufgerüttelt werde, zugleich „aber fast schon verbraucht“, müsse doch, so Rosenfeld, die Stimme der Aufrüttelung, der „verschütteten Zuversicht“ letztlich auch von innen heraus und nicht von einer Person, sondern von einer Gruppe kommen. (Ebd., 87) Nichtsdestotrotz erblickt er im Potenzial des Sprechchors, d.h. „tausend Stimmen in eine zu verschmelzen […] die Möglichkeit, die Totalität des Lebens wiederzugeben“ und auf diese Weise „das ersehnte Kollektivdrama“ zu erreichen (Ebd., 87), wobei er auch die neuen Medien wie das Radio – „Das Drama der Radiobühne wird ein Sprechchor sein“ – mit ins Kalkül zieht (Ebd., 88). In diese Richtung zielte auch seine eigene Sprechchordichtung Kerker, die am 2. Dezember 1925 als Einleitung zu einer Arbeitersymphonie-Vorstellung, musikalisch begleitet von Paul A. Pisk, zur Aufführung kam. D. J. Bach besprach diese Aufführung wohlwollend als Werk, das sich „offen und ausdrücklich zu den Ideen des kämpfenden Proletariats bekennt“ und nützte die Gelegenheit zu einigen grundlegenden Anmerkungen zum Sprechchor sowie zu Rosenfelds Beitrag. Dass der Chor, in Anlehnung zu antiken Modellen, selbst zum Träger der Handlung werde und zwar als „Ausdruck eines Massenwillens und Massenschicksals“ wird von Bach ausdrücklich begrüßt und als Möglichkeit einer neuen Verbindung von Sprache und Musik angesehen. Die Möglichkeiten des Chores, durch gegliederte Gruppen gleichsam symphonische Wirkung zu erzeugen, beeindruckt ihn dabei, auch die verantwortliche Regie durch Elisa Karau; allerdings ortet Bach in der sprachlichen Ausgestaltung noch bedeutende Schwächen, wenn er dem Text eine „poetische Phraseologie“ zuschreibt. (AZ, 3.12.1925, 20). Dies erklärt wohl auch, warum Rosenfeld selbst in seinem Beitrag für den „Kampf“ (1926) den Aspekt der (noch ungelösten) adäquaten Sprache und seiner Verschmelzung zum Kollektivdrama in den Vordergrund rückt. 1928 wird er einen weiteren Versuch vorlegen, Die Stunde der Verbrüderung, zu der es in einer redaktionellen Kurzkritik heißt, in ihm werde „zum erstenmal der Versuch unternommen, vom Oratorium oder Singspiel, der der Sprechchor bisher immer war, zur dramatischen Form vorzudringen, ohne Einzelpersonen zu Trägern der Handlung zu machen.“ (SW,28.8.1928,6) Dies erklärt vielleicht auch sein Interesse für jene Filmproduktion, die er als „Kulturfilm“ bzw. als „proletarisch-revolutionären“ Film bezeichnet, Produktionen, in denen – analog zur Literatur oder zum Sprechchor – revolutionäre Ausdrucksformen mit innovativen künstlerischen Ansprüchen zu einer Synthese gebracht werden wollen.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht sonderlich, dass Rosenfeld 1927 gleich drei Sparten gleichzeitig intensiv bearbeitet: die Filmkritik, aus der Beiträge zum neuen russischen Film herausragen sowie Einzel- und Sammelbesprechungen zu filmtheoretischen und filmsoziologischen Texten seit Bela Balázs, aber auch die bereits älteren, in den 1920er Jahren neuaufgelegten Arbeiten von Richard Guttmanngeb. am 20.10.1884 in Wien – gest. am 4.2.1923 in Wien; Schriftsteller, Journalist G. trat bereits vor dem Ersten Wel... und Carlo Mierendorff, die Literatur- und Theaterkritik sowie die eigene literarische Arbeit. Neu hinzu kamen schließlich kunstkritische Essays, z.B. über Käthe Kollwitz anlässlich ihres 60. Geburtstages (Die Unzufriedene, 9.7.1927,2-3) oder zu Frans Maserel (BA, 1927,95-96). Unter den zahlreichen Besprechungen literarischer Texte finden sich auch 1927 neben den bekannten Autoren (Hamsun, Kaiser, Rolland, Sinclair, Toller) bei genauerer Lektüre wieder erwähnenswerte Akzente: die Autobiographie der russischen Revolutionärin Wera Figner, die 1926 bei Malik unter dem Titel Nacht über Russland erschienen war(SW, 17.1.1927, 5-6), der Hollywood-Roman von Valentin Mandelbaum, allerdings bloß ein enttäuschender „Hintergrund für schablonenhafte Liebes- und Kriminalgeschichte“ (SW, 2.8.1927, 7) oder Joseph Roths Flucht ohne Ende, die Rosenfeld auf seine Weihnachtsbücher-Liste nahm und an dem er neben dem neusachlichen Berichtsgestus vor allem das radikale Demaskieren der bürgerlichen wie auch der revolutionär-bolschewistischen Welt (AW, 7.12.1927, 4) interessiert registrierte.
Was sich seit 1926 abgezeichnet hat, d.h. die beständig sich ausdifferenzierende Expertise im Bereich der Filmkritik, kommt 1928-30 vollends zum Tragen. Zwar zieht sich Rosenfeld von der Literaturkritik keineswegs zurück und liefert weiterhin präzise, oft in mehreren Zeitungen parallel veröffentlichte Autorenporträts und Buchkritiken, so z.B. zu Alfons Petzold, zu Maxim Gorki (BA 4/1928,79-82), Sinclair Lewis, Jack London, Upton Sinclair, Martin Andersen-Nexö, Edgar Wallace (beide BA 1929, Sonderbeilage Arbeiterbücherei, 43-45 bzw. 82-85) zu Arthur Holitscher (SW, 21.3.1928, 5) und – überraschenderweise – auch zur Erfolgsschriftstellerin Colette (AZ, 18.2.1928, 3-4) sowie zu Arthur Schnitzlers Therese-Roman (SW, 26.5.1928, 13-14), in dem Rosenfeld eine der herausragenden, über die „parfümgeschwängerte Atmosphäre jener alten Gesellschaft, die der Krieg hinweggefegt hat“ hinausreichendes „Menschenschicksal“ erblickt:
…ohne Pathos läuft ihr Leben ab, das Leben einer Frau und einer Mutter, die als Frau und als Mutter nur Schmerz erfährt. Diese schlichte Sachlichkeit ist hier keine Kunstmode, sondern nur Frucht tiefsten menschlichen Verstehens und Forderung größter dichterischer innerer Wahrhaftigkeit. […] mit seiner souveränen Beherrschung der machtvoll dahinströmenden epischen Form ist dieser Roman nicht nur eines der vollendetsten Werke Arthur Schnitzlers, sondern eine der bedeutendsten Erscheinungen im Romanschaffen dieses Jahrzehnts. (F. R.: Chronik eines Frauenlebens, SW, 26.5.1928, 14)
Grundlegendere Positionierungen treten ab 1928-29 insgesamt eher zurück und werden zunehmend in Sammelbesprechungen ausgelagert. Letzteres betraf z.B. das Themenfeld der Amerika-Romane (immerhin Kafkas Amerika-Text registriert, SW, 13.2.1928,5), die Adaption von Romantexten für die BühneGegründet 1924 durch den umstrittenen Zeitungsunternehmer Emmerich Bekessy, erschien die Zs. ab 6.11.1924 als Wochenzei... am Beispiel der Schwejk-Inszenierung an der Piscator-Bühne (SW, 12.3.1928, 5), die Würdigung neuer wichtiger Stimmen der ›Frauenliteratur‹ wie z.B. Anna Seghers (SW, 2.4.1931,3) oder – gleich mehrmals – das Genre ›Zeitroman‹ mit einem Spektrum von M. Gorki über B. Balazs, L. Frank bis hin zu den Brüdern H. und Th. Mann sowie U. Sinclair (AZ, 21.12.1929, 9) bzw. anhand neuer, billiger Bücherserien wie jene des Wiener E. Prager Verlags 1931. Dessen Reihe ›Das Gesicht der Zeit‹ brachte u.a. Fjodor Gladkows Zuchthaus-Roman Ugrjumow und Else Feldmanns Der Leib der Mutter, der bereits 1924 als AZ-Feuilletonroman erschienen war (SW, 29.8.1931).4 Selbstverständlich beteiligte sich Rosenfeld auch an der 1930 auf breiter Front aufgebrochenen Debatte über die Aufarbeitung des Krieges in literarischen und filmischen Texten: zunächst in einer ins Grundsätzliche gehenden Besprechung unter dem Titel Kriegsfilme (AZ, 20.12.1930, 9), dann in mehreren Einzelbesprechungen sehr unterschiedlich ausgerichteter Texte wie z.B. der aufrüttelnden Vision von Hans Gobsch Wahneuropa 1934 oder dem verklärenden, ausdrücklich als „gefährliches Kriegsbuch“ klassifizierten Ullstein-Spionageroman von Max Wild In geheimem Auftrag an der Ostfront (beide: AZ, 4.8.1931,5).
Rosenfeld war neben Ernst Lothargeb. am 25.10.1890 in Brünn (Brno) als Lothar Ernst Müller – gest. am 30.10.1974 in Wien; Schriftsteller, Kritiker, ... (NFP, 27.3.1931, 1-3) auch einer der wenigen, die anlässlich des 60. Geburtstages von Heinrich Mann sich nicht nur mit einer kurzen (Glückwunsch)Notiz zu Wort meldeten, sondern mit zwei großen Würdigungen und mehreren Beiträgen. Den Auftakt bildete die Besprechung des neuen Romans Die große Sache (AZ, 17.2.1931,7) gefolgt von einem ausgreifenden Werkporträt in der Salzburger Wacht am 27.3. 1931, die daraufhin auch in der BA erschien, einem weiteren Werkporträt unter dem programmatischen Titel Der politische Dichter, ebenfalls am 27.3.1931 in der AZ sowie der Besprechung des Essaybandes Geist und Tat (SW,13.7.1931,7). Rosenfelds Einsatz für Heinrich Mann zeugt dabei von profunder Kenntnis des Werks, von verständnisbereiter Aufnahme seiner durchaus bürgerlichen Themen der Jahrhundertwende-Texte und zeichnet genau und nachvollziehbar seine Entwicklung vom bürgerlichen Demokraten hin zum politischen Dichter, der nicht „Dichter der Partei, sondern der Idee ist“, nach. Ähnlich auch sein Geburtstagsporträt zu Sigrid Undset, Nobelpreisträgerin 1928 (AZ, 20.5.1932,6), deren Romane Ausdruck „hoher epischer Kunst, wie die Literatur der Gegenwart sie heute nur noch in Skandinavien“ vorfände, seien sowie seine Besprechung des Arbeitslosenromans Drei von drei Millionen von Leonhard Frank (BA 1932, Der Arbeiterbibliothekar, 121-122).
Es überrascht nicht, dass sich Rosenfeld bald nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus in Deutschland und der einsetzenden Gleichschaltungspolitik im kulturellen, literarischen und filmischen Leben mit Beiträgen zu Wort meldet, die wieder Grundsätzliches ansprachen, indem den je spezifischen Text oder Film mit den veränderten Rahmenbedingungen verknüpfen. Präziser greifbar wird dies zunächst in seinen Filmkritiken und Filmglossen ab Mai-Juni 1933, z.B. über die Auswirkungen der „›Gleichschaltung‹ des deutschen Films, die seine Ausschaltung aus der Kulturwelt bedeutet“ für die Gestaltung des Wiener Kinoprogramms, das sich gezwungen sieht, den „Spielplan mit amerikanischen Tonfilmen zu bestreiten“, der wie folgt eingeschätzt wird: „Es versteht sich, daß nicht nur die Spitzenwerke Hollywoods über den Ozean kommen; aber auch die mittleren und kleinen amerikanischen Filme […] unterscheiden sich vorteilhaft von der deutschen Filmkonfektionsware, mit der wir jahrelang gefüttert wurden“(AZ, 26.6.1933,3). In der 2. Jahreshälfte nimmt auch die Buchkritik den NS zunehmend ins Visier, ebenso seine Vortragstätigkeit und indirekt wohl auch die erneute Zuwendung zu jüdischen Themen. So hielt er am 30.9. 1933 im Arbeiterbildungsverein Alsergrund einen einleitenden Vortrag unter dem Titel Verbrannt und verbannt zu einem Rezitationsabend über Verfemte deutsche Dichter, thematisierte also die Bücherverbrennung und das Exil – etwa zeitgleich zu E. Fischers wichtigem programmatischen Essay Den Kompaß über Bord? und vor Brechts bedeutendem Gedicht Über die Bezeichnung Emigranten. Im Dezember 1933 folgte schließlich eine weitere programmatisch ausgerichtete Besprechung zu Lion Feuchtwangers Die Geschwister Oppenheimer, die unter dem Titel stand: Das Dritte Reich im Roman (AZ,17.12.1933, Beilage Arbeitersonntag). Unmissverständlich stand da bereits im ersten Satz zu lesen, dass Feuchtwanger
[…] als erster die Fratze des braunen Fascismus in einem Epos nachgezeichnet [hat]: dem Roman ›Erfolg‹, der ihm den bittersten, blutigen Haß der Hakenkreuzler zuzog und ihn zwang, beim Ausbruch der großen Barbarei Deutschland zu verlassen.

Trotz zugespitzter Diktion in Bezug auf die „Kulturkatastrophe der ›nationalen Revolution‹“ mit ihren Orgien von Gewalt und Bestialität – Rosenfeld erwähnt explizit „wehrlos Gepeinigte[n] in den Kerkern der Kasernen, in den Konzentrationslagern“ – erkennt er genau, dass der als jüdischer Familienroman strukturierte Text Feuchtwangers mit seiner Geschwisterkonstellation eigentlich den Nationalsozialismus, eingebunden in eine „Art politischer Chronik“, und seine wirtschaftlichen, (un)moralischen, gesellschaftlich-ideologischen Wurzeln und Verflechtungen sowie seine barbarischen Praxen zum Protagonisten macht (Ebd.). Den Schlusspunkt seiner literaturkritischen Arbeit setzte ein Beitrag unter dem Titel Theater an der Wende in der Salzburger Wacht am 2.1.1934. Darin beklagt Rosenfeld vor allem den Umstand, dass „das Theater von heute […] nach seiner gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, aber auch nach seiner seelischen Struktur der Welt von gestern an [gehört]“, d.h. als bürgerlich-biederes Unterhaltungstheater nur „locker und dürftig“ mit den Fragen der Gegenwart zusammenhänge, ja die ehemals emanzipatorische Funktion des bürgerlichen Theaters geradezu pervertiere, war dieses doch einmal „eine Angriffswaffe von unerhörter Wucht und Durchschlagskraft“, wofür er die Leistungen von Beaumarchais, Lessing, Schiller, Büchner, Hauptmann bis herauf zu Ibsen, Strindberg, Kaiser, Toller und Wedekind anführt. Den gegenwärtigen Herausforderungen werde das Drama dagegen nicht mehr gerecht:
Die Probleme, die das Drama von heute gestalten müßte, sind kollektivistischer Natur, Kämpfe von Klassen, von Interessensgemeinschaften, ein Ringen nicht nur um Ideen, sondern um sehr reale Lebensmöglichkeiten: Das letzte große Kollektivdrama war Tretjakows „Brülle China!“. Hier griff man bereits zum Aushilfsmittel des Films, um den engen Rahmen der Bühne zu erweitern. Der dramatische Stoff unserer Tage sprengt die Grenzen des Theaters.“ (Ebd., 6)
Das Theater muss sich daher „Aufgaben stellen, die der Film nicht erfüllen kann, nicht erfüllen will“, unter anderem müsse es „die Zeit in die Zukunft spiegeln, die ewigen Melodien menschlichen Leids und menschlicher Freude aus verschollenen Epochen […] klingen lassen…“ (Ebd., 7).
4. Aspekte der Film(kultur)kritik
Wie bereits erwähnt, nahmen seit Ende der 1920er Jahre die Filmkritiken an Gewicht (und Anzahl) zu, v.a. seit der Einführung der AZ-Rubriken ›Welt des Films‹ und ›Film der Woche‹, die Rosenfeld maßgeblich betreut und gestaltet hat. Aus den über 1000 filmkritischen Beiträgen bis Ende 1933 können hier nur einige wiederkehrende, ihm wichtige thematische und filmästhetische Akzente angesprochen werden.5 Ein Leitmotiv bildete etwa die Frage nach der (In)Kompatibilität von Spielfilm und Kulturfilm, die in manchen Fällen glücken könne, so am Beispiel von Geheimnis einer Seele; (AZ 11.7.1926, 23-24) oder im Hofmannsthalschen Rosenkavalier-Film, in anderen wieder nicht wie z.B. im Faust-Film, der „auch durch die Regie von F.W. Murnau nicht rettbar“ wäre (AZ, 24.10.1926, 22-23). Damit verknüpft war für Rosenfeld die ins Grundsätzliche zielende Frage der Kommerzialisierungs- und Kitsch-Tendenzen in der (vorwiegend amerikanischen und deutschen) Filmproduktion und ihrer inhärenten moralisch-kapitalistischen Indoktrination. Am Beispiel des erfolgreichen Stummfilms Die Zehn Gebote/The Ten Commendaments (1923, Regie: Cecil B. DeMille) formuliert Rosenberg unter dem ins Ironische gewendeten Titel Das Kino als moralische Anstalt gegen den zeitgenössischen Mainstream, der dem Film Rosen streute, ungeschminkt seine Vorbehalte:
…ein großaufgemachtes Musterbeispiel für die Geschäftstüchtigkeit des amerikanischen Filmkapitals, eine Übersicht über das technische Können der Amerikaner und über ihre Lieblingsstoffe, verlogene, heuchlerische Tugend- und Demutspredikt, mit weltfremdem, rosenrotem Optimismus übergossen. (AZ, 1.4.1925, 9)
Großes Augenmerk richtete Rosenfeld daher auch und gerade auf die Entwicklungen im russisch-sowjetischen Film sowie auf Aspekte moderner, avantgardistischer Filmkunst und Regieleistungen.6 Neben dem Werk von Eisenstein besprach er z.B. in höchsten Tönen den russisch-proletarischen Film Der blutige Sonntag aus (AZ, 30.7.1926, 9); er würdigte aber auch die Regieleistung Berthold Viertels in Die Abenteuer einer Banknote (AZ, 31.10.1926, 20), setzte sich wiederholt mit Charlie Chaplin auseinander und hoffte 1928 mit Verweis auf ansprechende Produktionen von Max Neufeldauch Massimiliano, geb. am 13.2.1887 in Guntersdorf (Hollabrunn/NÖ), gest. am 2.12.1967 in Wien; Schauspieler, (Film)Re... „das Schicksalsjahr des österreichischen Film“ anbrechen zu sehen (SW, 4.1.1928, 5-6), das sich freilich nicht einstellen sollte. Einer seiner filmpolitischen wie filmästhetischen Grundsatztexte ging 1929 aus einem Radiovortrag hervor: Der Arbeiter und der Film (Radio Wien 30.1.1929 bzw. BA 2/1929,17-19). In wenigen Sätzen skizziert Rosenfeld zunächst den großen Bedeutungswandel des Films vom ursprünglich misstrauisch beäugten „Pöbelvergnügen“ hin zu einem „unbestrittenen selbständigen künstlerischen Ausdrucksmittel“, das neben ästhetischen und kulturellen Meriten wie die Kreation einer internationalen Filmsprache auch bedeutende wirtschaftliche Aspekte aufweise: neben den primär kapitalistischen der Filmindustrie auch solche neuer, moderner Arbeitsplätze. Als mediale Revolution stehe der Film an vorderster Front veränderten Kulturkonsums und damit auch gesellschaftlicher Ansprüche und Beanspruchungen mit zuvor ungekannten Rezeptionsmöglichkeiten. Denn die Filmwerke bzw. „Schöpfungen Chaplins, Fairbanks, Buster Keatons oder einer der bedeutenden Russenfilme“ sprechen hunderte Millionen von Menschen „über alle Grenzen der Völker“ an, sodass es heute „kaum mehr ein künstlerisches Ausdrucksmittel“ gebe, „das eindringlicher, zwingender wäre als die visuelle Gestaltung eines Erlebnisses durch die Hand eines großen Filmkünstlers“ (Ebd, 17f.). Die Wirkungsmacht – manipulative, aber auch potentiell aufklärerische – des Films auf der einen Seite klar vor Augen, die finanziell-organisatorischen Rahmenbedingungen auf der anderen im Bewusstsein, kommt Rosenfeld zwangsläufig auf die gesellschaftlich-ideologische Funktion, aber auch auf noch nicht ausgeschöpfte Potenziale der Filmkultur und der ihr zugehörigen Kino-(Infra)Struktur zu sprechen. Unmissverständlich legt er dabei die Interessenslagen und die Manipulationsmaschinerie der Filmindustrie offen; so gebe es gemäß vieler Filmproduzenten und ihrer Finanziers „nichts Überflüssigeres […] als die großen sozialen Auseinandersetzungen, die unsere Gegenwart erfüllen“ (Ebd., 19). Ähnlich wie Bertolt Brecht zur selben Zeit mit Bezug auf das Radio fordert auch Rosenfeld einen grundlegenden Paradigmenwechsel: weg vom bloß konsumierenden passiven Distributionsprinzip hin zu einer partizipativen Produktionskultur, die auf einer Arbeiterkino-Infrastruktur gründen und somit Einfluss auf die Programmgestaltung ermöglichen soll, um langfristig die Rezeptionshaltung des Publikums mitzugestalten, ferner die Produktion entsprechender Filmwerke, wie z.B. Leo Lanias „Zwei Filme der Wirklichkeit“ Schatten der Maschine bzw. Hunger in Waldenburg (AZ,17.5.1929,17). Eine Perspektive, die durch die von der Arbeiterbank mitbegründete Kino-Betriebsgesellschaft KIBASigle für: Kinobetriebs-, Filmverleih- und Filmproduktionsges,mbH, gegr. 1906 in Wien, übernommen als Kinobetriebsanst... anfangs wohl angepeilt, bald aber aus kommerziellen Gründen aufgegeben, ja aktiv verdrängt wurde. Rosenfeld musste mitansehen, wie die KIBA-Geschäftsführung dieselben Praktiken anwendete, die ansonsten einer scharfen Kritik unterzog, was zu Spannungen in der AZ-Redaktion, mit der Kunststelle und zum Parteivorstand führen musste und einen Teilrückzug Rosenfelds zur Folge hatte. Verschärft durch die Krisenjahre ab1929 sowie durch die monopolartige Marktsituation wurde Rosenfelds Hoffnung in den Aufbau einer alternativen, ästhetisch anspruchsvollen und (gesellschafts)politisch nutzbaren Kinokultur rasch enttäuscht (Hausjell, 851). Schärfster Ausdruck dieses Dissens war Rosenfelds Abrechnung Sozialdemokratische Kinopolitik in der Aprilnummer 1929 der Zeitschrift Der Kampf. Darin hieß es u.a.
In Wien verfügt die Arbeiterschaft heute über eine Reihe von Kinos, die eine Macht darstellen; man kann – man könnte – mit ihr auf das gesamte Wiener Kinowesen einwirken, es umlenken, das Erscheinen von Filmen ermöglichen, das Erscheinen reaktionärer Filme verhindern. Nichts desgleichen geschieht. Wenn ein guter Film da ist, den niemand spielen will, so kann man auch auf die Arbeiterkinos nicht rechnen (der ausgezeichnete Film ›Ringelspiel‹ und der prachtvolle pazifistische Film ›Der Herzschlag der Welt‹ wurden in keinem einzigen Wiener Arbeiterkino gespielt!), wenn aber ein reaktionärer Film da ist, so wird er in fast allen diesen Kinos aufgeführt. (K. H.4/1929,192-197; 195)
Rosenfelds Breitseite gegen die KIBA-Verantwortlichen, die er auch an anderen Stellen in ähnlicher Diktion wiederholte, so 1930 in der Programmzeitschrift Kunst und VolkZwischen 1926 und 1931 von David Josef Bach im Auftrag der Sozialdemokratischen Kunststelle herausgegebene sozialdemokra... in seinen Überlegungen zum Tonfilm und Theater, zeigten nicht die erhoffte Wirkung (Hausjell, 852); zugleich ließ er sich nicht entmutigen. So widmete er dem tschechischen, das Prinzip der Montage konsequent durchhaltenden Stummfilm ohne Handlung So ist das Leben eine ausführliche Besprechung in der AZ, lobte den Regisseur als einen „Dichter in Bildern“ (AZ, 1.6.1930, 19). 1931 pries er Alexis Granowskys Lied vom Leben als den „schönsten Tonfilm“ an (AZ, 31.5.1931, 19) und dies ebenfalls aufgrund der überzeugenden Montagetechnik, der diesen Film in eine Reihe stelle, die von Eisenstein über Ruttmann zu Pudowkin reiche. Er würdigte aber auch Chaplins Lichter der Großstadt sowie die Berlin Alexanderplatz-Verfilmung in höchsten und kompetenten Tönen (AZ, 3.4.1931, 7 bzw. 25.10.1931, 19) sowie die „wundervollen“ Filme des jungen ungarischen Regisseurs Paul Fejos wie z.B. Ringelspiel oder Marie (VP,31.3.1933, 7). In diesem Kontext überrascht die Einschätzung von Louis Trenkers Kriegsfilm Berge in Flammen, den Rosenfeld keineswegs als Ausdruck von Heldentum oder Nationalismus versteht, sondern wegen einer geradezu „sparsam“ zur Anwendung kommenden „…Darstellung der Schrecken des Dolomitenkrieges“ als Hommage an die „Heimatliebe“ sowie jene der Bergwelt, welche am Ende einen österreichischen Soldaten und einen italienischen Offizier „wieder als Freunde auf ihren geliebten Bergen“ zusammenbringen kann. Dieser weitgehend der Stummfilmtechnik verpflichtete, von Gegenlicht-Aufnahmen und beeindruckenden Geräuschkulisse getragene Film wurde in der Scala im Beisein von Trenker mit Orgelvortrag sowie „Darbietungen der Scala-Jazz“ – Band erstmals vorgeführt (AZ, 31.10.1931, 6).
Unter den Besprechungen des Jahres 1932 dürfen hier zwei kurz angeführt werden, die im Kuckuck erschienen, in jener Wochenschrift, mit der die Sozialdemokratie ideologisch kompatible Unterhaltungskultur zu lancieren versuchte: Ein Meister der Filmregie. Zu den Filmen von Ernst Lubitsch (Kuckuck, 16.10.1932,14-15) sowie sein Einleitungsvortrag zur Vorführung von 15 französischen Avantgardefilmen im Volksbildungsheim Margareten am 15.12.1932 Die Avantgarde. Filmkunst ohne Filmkapital (Kuckuck, 11.12.1932, 15-16). Lubitsch’s Regie-Entwicklung vom historischen Ausstattungsfilm über Charaktertragödien hin zu grotesken, parodistischen Komödien und dramatischen Bilderzählungen versteht er dabei in engem Konnex mit der „Entwicklung des künstlerischen Films“ überhaupt. Herausragend waren dabei der Golem-Film mit Paul Wegener in der Hauptrolle oder Madame Dubarry, in dem gar „[…] der Atem der Revolution [wehte]. Mit dem neuesten Film Der fremde Sohn, basierend auf dem pazifistischen Drama Der Mann, den sein Gewissen trieb von Maurice Rostand, habe er nun einen „Film der wuchtigen Anklage gegen den Krieg und die patriotische Phrase“ geschaffen, – ein klares Signal an die Zeit und ihr Publikum.
Generell konstatierte er allerdings für 1932 eine Weltkrise des Films, die – bezogen auf Deutschland – in zahlreichen Firmenzusammenbrüchen und „Operettenschwachsinn“ begründet lag sowie in der zunehmend sichtbaren Allianz zwischen NS-Finanziers wie Hugenberg und einem Teil der Filmindustrie (AZ, 1.1.1933, 19), eine Tendenz, die sich ihm 1933 bestätigte, unbeschadet einiger weniger Ausnahmen wie z.B. die Max Ophüls-Verfilmung von Schnitzlers Liebelei (AZ, 26.2.1933,15), die Kollektivfilme Mädchen in Uniform (Regie: Leontine Sagan) und Kuhle Wampe, die Berglegende Das Blaue Licht (AZ, 1.1.1933, 19), das komplexe amerikanische Ehedrama Leidenschaft (AZ, 26.6.1933, 3) dem andererseits der „reaktionäre Sensationsfilm“ Shanghai-Express gegenüberstände. Auch der russische Film, insbesondere der Tonfilm, habe seit Alexander Dovženkos bereits 1930 fertig gestelltem Stummfilm Semlja (Die Erde dürstet) kaum Nennenswertes vorgelegt. Rosenfelds letzte Jahresbilanz Demaskierung des Films (AZ, 31.12.1933, Beilage,4-5) bekräftigt eindringlich und plausibel, was ihm schon 1932 als Perspektive, d.h. der Missbrauch des Films zur „Aufrüstungspropaganda“, vor Augen gestanden war.
Dass Rosenfeld zu manchen Tendenzen und Debatten Positionen entwickelte bzw. bezog, die aus heutiger Sicht konservativ oder ideologisch inspiriert erscheinen mögen, liegt nicht nur angesichts der Vielzahl seiner Beiträge auf der Hand sondern auch darin begründet, dass Entwicklungen an den Schnittflächen von etablierten künstlerischen Formen und neuen medialen Möglichkeiten und Potentialen in zeitgenössischer Sicht durchaus umstritten und im Brennpunkt ästhetischer und kulturpolitischer Debatten standen. Das traf z.B. auf Diskussionen und Positionierungen im Kontext neusachlicher Literatur und Kunst zu, insbesondere auf die Aspekte des Dokumentarischen und der Reportage. Erschien ihm letzteres für den Film unter dem Stichwort ›Montage‹ als künstlerisch innovativ und (kultur)politisch gerechtfertigt, wenn nicht gar notwendig, so bezog er im Bereich der Literatur eher Distanz z.B. zur Reportage-Debatte, an der immerhin auch Leo Lania in mehrfacher Weise und an prominenten Orten (man denke nur an seine Kooperation mit Piscator oder Brecht) mitgewirkt hat.
5. Vom novellistischen Erzählen über den Sprechchor zum Roman
Als Erzähler ist Rosenfeld bislang kaum bekannt, geschweige denn literarhistorisch greifbar, sieht man von seinem Filmroman Die schwarze Galeere (1930) sowie von seinen Kinder- und Jugendbüchern ab, durch die er seit Anfang der 1930er Jahre, vor allem aber vom englischen Exil aus, eine über den deutschsprachigen Raum weit hinausreichende Resonanz erfahren hat.7
Bereits 1923, im ersten Jahr seiner Mitarbeit an der AZ, veröffentlichte Rosenfeld zwei mehrteilige Erzählungen, unter denen die als Novelle ausgewiesene Die Verfluchten als Talentprobe angesehen werden kann. Thema dieser Novelle, die zugleich eine beeindruckende Großstadtzeichnung einer Hafenstadt ist (Link), sind Orientierungs- und emotionale Konflikte eines jungen Mannes (Albert), der von der Unbefangenheit, mit der ihm junge Frauen gegenübertreten, völlig überfordert wird. Ein Freund bezichtigt ihn gar eines unzeitgemäßen Pathos und Weltschmerzes und versucht ihn nach einer ersten Enttäuschung mit Hilfe einer anderen Frau zu kurieren. Die daraufhin arrangierte Begegnung mit Lotte stürzt Albert jedoch in ähnliche Gewissenskonflikte: während sie sich in ihn verliebt, verspürt er alsbald ein Gefühl, „daß er dieses junge, erwartende Weib mißbrauche“ (AZ, 14.8.2017,9), insbesondere nachdem sie sich ihm, auf seinen Wunsch hin, hingibt, „Teil seines Ichs“ geworden ist. Gerade diese Hingabe ist es, die Albert zunehmend als Last empfindet, aus der er nun zu flüchten trachtet. Unfähig, dies mit Lotte aufzuarbeiten, greift er am Ende zur radikalsten aller denkbaren Lösungen, zum Freitod, sich selbst in einem Abschiedsbrief als „lebensunfähiger Träumer“, anklagend, aber auch die gesellschaftlichen Konventionen mitverantwortlich machend, an denen er zerbrochen sei, weil er „nicht genügend Brutalität“ (AZ, 16.8.1923, 7) aufzubringen imstande war.
Während diese Novelle deutlich Züge der Bindungs(unfähigkeits)thematik der Jahrhundertwende trägt, auch eine schablonenhafte Sprache zitiert, verlagert sich in seinem ersten Roman, dem in 39 Folgen in der SW abgedruckten Text Johanna der Akzent geradezu drastisch ins Soziale. Johanna, Kind einer armen Taglöhner-Familie, wird früh zur Waise und in die Nachbargemeinde zum billigst möglichen Tarif als Kostkind zu einer alten Frau gegeben. Nach anfänglich erträglichem Auskommen verfällt diese Frau der Trunksucht; Johanna erfährt erstmals Gewalt und Ausbeutung ihrer kindlichen Arbeitskraft, bis eines Tages die armselige Hütte durch ein Missgeschick niederbrennt, wobei die Alte den Tod findet. Johannas nächste Station ist der Hof des Bürgermeisters, auf dem sie als billigste Magd gehalten wird: „An ihrer Kraft wurde Raubbau betrieben, auf ihrer Seele herumgetreten.“(SW, 17.10.1924, 5). Zugleich wächst sie dort zu einer jungen Frau heran, muss mit diesem Wandel zurechtkommen, d.h. die Avancen des Bauern oder anderer Männer abwehren und gleichzeitig mit der eigenen erwachenden Sinnlichkeit, etwas, das ihr neu ist und sie verunsichert, umgehen lernen. Auch zum Sohn des Bauern entwickelt sich verhalten eine Beziehung, doch dieser ist nicht imstande, zu ihr zu stehen, demütigt sie, als es gilt, sein Wort zu halten, woraufhin sie faktisch zum Freiwild erklärt wird. Als Folge davon wird sie Opfer einer Vergewaltigung durch einen derb-dumpfen Burschen, schwanger und vom Hof verstoßen, d.h. in die benachbarte Stadt abgeschoben. Dort versucht sie sich als Haushaltshilfe durchzuschlagen, findet anfangs auch eine befriedigende Anstellung in einer bürgerlichen Familie, wo sie Schreiben und Lesen lernt. Zu deren Sohn entspinnt sich bald ein geheimes, intimes Verhältnis, das beider Bedürfnisse befriedigt. Doch auch dort gerät Johanna ins Visier des Hausherrn, der sie eines Nachts mit Gewalt zu nehmen sucht. Sie wehrt sich, Zeichen eines veränderten Bewusstseins; – der Skandal ist trotzdem unausweichlich, kann sie auch hier der Sohn nicht vor dem Vater schützen, woraufhin sie die Stellung wechseln muss. Nach dieser Erfahrung dreht sich die Spirale nach unten, sie landet eines Tages bei einer sogenannten Gräfin, die sie schamlos ausbeutet, ihr den Lohn vorenthält, worauf Johanna sich das ihr zustehende Geld holt und aus der versperrten Wohnung ausbricht. Die Folge ist eine Anzeige und Verurteilung zu drei Monaten Haft: Klassenjustiz, die zwar plakativ vorgeführt wirkt, aber wohl den Verhältnissen Anfang der 1920er Jahre nahe kam.
Nach ihrer Enthaftung fällt Johanna nur noch tiefer, was immer sie auch versucht: zur Bettelei wie zur Prostitution gezwungen gerät sie, reduziert auf ein „Geschlechtstier“ (SW, 24.11.1924, 4) an den Rand der Gesellschaft, wird obdachlos, krank, irrt durch Gassen und kehrt am Ende verzweifelt in das Dorf, aus dem sie einst vertrieben wurde, zurück, in der Hoffnung, dort das nötige Brot für ein kärgliches Auskommen finden zu können. Doch die Dorfbewohner, angefangen vom ehemaligen Bauernsohn, verhalten sich kalt und abweisend. Auch der Pfarrer, ihre letzte Hoffnung, verstößt sie, nachdem sie auf die Frage nach Reue und Schuld nur antworten kann „Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Ich bin mir nur bewußt, gearbeitet zu haben für andere, ausgenützt worden zu sein und gehungert zu haben“, worauf er ihr wütend entgegnet: „Ich ahne das rote Gift in dir! Du bist der Verführung erlegen! Dein Leben war voll Sünde…“ (SW, 1.12.1924,5). Auf die verzweifelte Bitte nach ein wenig Brot und Milch kommt ein harsches „Nein“; Johanna verlässt das Dorf und wird am nächsten Tag tot neben ihrem wimmernden Kind aufgefunden.
Der Roman mag manche Schwächen aufweisen, manche grelle Zeichnung, die an Pathos und Kolportage erinnert. Trotzdem muss man ihm zugestehen, ein eindringliches Schicksal realitätsnah und sprachlich gut auf die jeweiligen sozialen Welten abgestimmt gestaltet zu haben, ohne die ihm innewohnende Tendenz wie z.B. die Kritik an den Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen im Dorf, an der Reduktion des rechtlos angesehenen weiblichen Dienstbotenkörpers zur Ware oder die Konfrontation mit der verlogenen Rhetorik der Kirche und der falschen Familienidyllen plakativ zu ideologischen Botschaften zu missbrauchen.
Die seit der 1. Mai-Aufführung (1924) von Tollers Tag des Proletariats auch in Wien einsetzende Sprechchor-Bewegung motivierte Rosenfeld, sich damit sowohl konzeptuell als auch in Form eigener Beiträge mit diesem neuen, die Form des Kollektiv- und Massendramas anstrebenden Genre zu befassen. Mit Kerker gelang ihm, zeitgleich zu Ernst Fischers Der ewige Rebell, auch ein erster, im Rahmen der Republikfeiern 1925 aufgeführter Beitrag, der an die expressionistische, ins Revolutionäre getauchte Erlöserthematik anknüpft. Rosenfeld konnte hier auch sprachlich an seine ausdrucksintensive und akzentuiert rhythmische Prosa anknüpfen. Rhythmisches Sprechen charakterisiert dann auch einen weiteren Kurzprosa-Text, Die Kette, der 1926 in der Weihnachtsausgabe der SW erschien. Er präsentiert hochdramatische Szenen eines Schiffsuntergangs, insbesondere die Rettung privilegierter Damen und distinguierter Herren sowie der brutale Opferung vieler anderer Passagiere in einem ekstatisch, elliptisch, aufgepeitscht wirkenden minimalistischen Sprachrhythmus.
In den nachfolgenden Jahren kommen vereinzelt weitere Kurzprosatexte zum Abdruck sowie Sprechchorwerke, u.a. Die Stunde der Verbrüderung (1928), Das Herz im Asphalt sowie Die Toten klagen an (beide 1931; Link), doch Rosenfelds Augenmerk gilt zunehmend zwei anderen Formen: dem Roman über die Filmindustrie und legendenartigen Kinder- und Jugendbuch-Erzählungen.
Als „Eine Waffe im Kampf um den Film“ (SW, 14.3.1931,16) wird in einer Anzeige der wohl wichtigste, zugleich auch umfangreichste Text Rosenfelds vor 1933, sein Roman Die goldene Galeere (1931), der zunächst zwischen November 1930 und Jänner 1931 in über sechzig Fortsetzungsfolgen in der AZ erschien, angepriesen.8 In der Tat ist er nach Arnold Höllriegels Hollywood-Roman Du sollst Dir kein Bildnis machen (Kucher, 2011, 362f.) einer der wenigen Romane über die Filmwelt, jedenfalls der konsequenteste über die zeitgenössische Filmindustrie. Rosenberg kann dabei auf seine Kompetenz als Filmkenner und Filmkritiker zurückgreifen, verlegt das Geschehen nach Berlin, nicht ohne die Amerikanisierung des Film-Feldes gänzlich auszusparen. Geraffte Syntax, Leitvokabeln wie Girltruppe oder Revuegirls, beständiges Läuten des Telephons, Honorardebatten und Pressearbeit rücken von Beginn an die ökonomisch-kommerziellen Aspekte der Filmarbeit in den Vordergrund, während die künstlerischen Aspekte in die zweite Reihe zurücktreten müssen, Ulfars (Name des positiv besetzten Protagonisten) anspruchsvolle Drehbücher gegen den Pragmatismus des Regisseurs Prager trotz Sympathien auf Seite eines zerstreuten, durch Talententdeckungen beständig abgelenkten Produzenten keine Chance auf Realisierung haben. In einem Gespräch stellt dies Prager ziemlich unverhohlen klar:
…will Ihnen nicht verhehlen, daß ich über diese Dinge im Wesentlichen ähnlicher Meinung bin wie Sie, aber beim Film hat alles sein Aber – diese modenrne Piraten, als die sie die Bankiers und Finanzritter hinstellen, die Konzernmagnaten und Industriebarone, gerade diese Leute sind es, die uns finanzieren. Das Geld, mit dem wir Ihren Film von den modernen Piraten drehen würden, müsste von einem dieser modernen Piraten kommen. (GG, 46)
Prager, der gern den Typus des experimentieroffenen Regisseurs mimt und im privaten Gespräch die Marktausrichtung und die Produktionsumstände des Films geißelt, hat sich längst an den Betrieb verkauft und seinen Regeln unterworfen. Es geht letztlich nur mehr um aufgesetzte Akzente, um den Kitsch, der produziert wird, nicht gleich als Kitsch erkennbar zu machen, z.B. um ein „geschickt erfundenes Detail, eine kluge Dialogwendung“ (GG,50), in der freilich weniger die Kritik an misslichen Verhältnissen als – am Beispiel einer problematischen Mutter-Tochter-Konstellation – eine pikante Hintergrundstory aufblitzen darf. Formal kann der Romantext dabei auf die Sprache und Form eines Filmscripts durch Zitat von Auszügen im Zuge einer Diskussion eingehen, d.h. hierbei auch Ähnlichkeiten und Differenzen in sprachlich-ästhetischen Verfahrensweisen (Schnitttechnik, Reduktion des Sprachlichen zugunsten des Visuellen, Einstellungen versus Perspektiven) thematisieren (Kucher, 2011, 369). Ulfar will diesem Betrieb entkommen, indem er zum einen Drehbücher nicht annimmt oder kleine Modifikationen einarbeitet, zum anderen indem über eine Schauspielerin, Eldrid, die zum Star aufgebaut wird und zu der er eine Beziehung unterhält, seine Stellung zu stärken versucht. Beides ist unbefriedigend, an beiden Aspekten entwickelt Rosenfeld die zerstörerische Wirkung der Kitsch-Kommerzproduktion, die im Roman ihren Tiefpunkt darin erreicht, dass es dem Produzenten gelingt, Eldrid zu seiner Geliebten zu machen, einem Filmsternchen, das zwar die Aktien der Produktionsfirma in die Höhe treibt und Erwartungen der Boulevardpresse bedient, aber ihr Filmleben mit dem realen Leben eintauscht: „Sie starb in Glanz, sie lebte ein totes Leben“ (GG, 252). In dieser tristen, von Demütigungen zugespitzten Lage gelingt es Ulfar, gemeinsam mit dem inzwischen geläuterten Regisseur Prager und einigen Freunden ein Modellprojekt umzusetzen, das den Gedanken des proletarischen Kinos aufgreift: eine Symphonie des Lebens, die an Carl Junghans‘ So ist das Leben (1929) anklingt sowie an Alexis Granowskys Das Lied vom Leben (1931), – beides Filme, die Rosenfeld hymnisch in der AZ besprochen hat bzw. wird. Entgegen den Marktbedingungen und zeitgenössischen Rezeptionshaltungen wird der Film doch zu einem Erfolg, allerdings erkauft um den Preis der emotionalen Niederlage des Protagonisten. Paradoxerweise transferiert Rosenfeld in diese Schwarz-Weiß-Wendung Elemente der von ihm stets kritisierten und als Kitsch-Illusion gebrandmarkten Spielfilmdramaturgie, Elemente, die, im Verein mit den filmkulturellen, mitunter propagandistischen Botschaften, einer breiteren Aufnahme des Romans wohl auch im Wege gestanden sein dürften.
6. Kinder- und Jugendliteratur
Mit dem Band Mitsanobu, 1929 in der Büchergilde Gutenberg erschienen, und wie nachfolgende Texte fernöstliche Denkweisen mit sozialen, zeitlich übergreifenden Anliegen verknüpfend, um dabei das Genre der Legende neu zu konturieren, d.h. mit utopischer Substanz zu unterfüttern, legt Rosenfeld seinen ersten Text der insbesondere im Exil weiterentwickelten, die spätere Rezeption des Autors bestimmenden Erzählgattung vor. Mitsanobu, ein japanischer Arzt, der in China wirkt, ist eine „irrende Prometheus“-Figur, die über einen Zauberstab die Möglichkeit erhält, sich einen Wunsch zu erfüllen. Dieser besteht darin, Wissen lebendig erhalten zu wollen, d.h. es gewissermaßen transplantieren zu können, damit es mit dem Tod eines Wissenden nicht verschwinde. Als ihm aber der Stab entwendet und missbräuchlich verwendet wird, ändert Mitsanobu, auch unter dem Eindruck einer Opferungsgeste eines ihn liebenden chinesischen Mädchens, seine Einstellung: nicht mehr die Stapelung von Wissen ist ihm wichtig, sondern die „Entflammung der Herzen“. Diese führe nämlich zur Einsicht, „daß der Schmerz allein, die Empörung über das Leid die Menschheit zur Selbstbefreiung“ anstacheln könne, wie O. Koenig in einer der wenigen zeitgenössischen Besprechungen anmerkte. (AZ, 21.12.1929, 9). Auch das nachfolgende moderne Märchen „für denkende Kinder“ Tirilin reist um die Welt (1931) verbindet klassische Märchenerwartungen mit der Konfrontation mit den Verhältnissen der Zeit, um neben spannenden Erlebnissen, u.a. in einem Bergwerk, aber auch in Hollywood, zwar keine Entzauberung, aber einen Erkenntnisgewinn herbeizuführen, den nämlich, dass eine märchenhafte Welt möglich ist, wenn man nur um diese kämpft, d.h. die sozialen Ungerechtigkeiten zu beseitigen sucht. Felix Kanitz hat dieses Buch in einer Besprechung denn auch unter die Leitperspektive „Endlich ein sozialistisches Märchenbuch!“ gestellt.9 Insofern kann man Rosenfelds kinderliterarische Texte als Fortsetzung seines (sozial)politischen und kunstkritischen Engagements verstehen und mit klassischen Texten utopischer Aufbruchsvisionen, etwa Kafkas Amerika-Text Der Verschollene (ED 1927) verknüpfen und nicht nur als desillusionierten ersten Schritt in eine innere Emigration (Seibert, 2017). Auch der dritte und vor seiner Flucht nach Prag 1934 letzte kinder- und jugendliterarische Text Der Flug ins Karfunkelland erschien Ende 1933. Er greift Motive aus Tirilin auf, d.h. auch darin überwiegt das Reisen, allerdings weniger um Abenteuer zu erleben, sondern um Einblick in andere Welten zu gewinnen und Erkenntnisse zu sammeln. Das Auge, das der Junge (Karfunkel) für seine Katze sucht, wird ihm im ›Berg des Leuchtens‹ jedoch nicht geschmiedet, womit zugleich eine Kritik an der Illusionsproduktion von Märchen fassbar wird. Diese drei Texte legen die Basis für die in den späten 1940er Jahren vom englischen Exil aus einsetzende fruchtbare Produktion weiterer Jugendbücher, beginnend mit dem Longseller 1414 geht auf Urlaub (1948) bis hin zu seinem letzten Ein total verrücktes Haus (1988), – über 60 an der Zahl.
7. Exil und verweigerte Remigration
Noch am Tag vor dem 12. Februar 1934 veröffentlichte Rosenfeld in der AZ mehrere Filmempfehlungen u.a. zum Don Quichotte-Film von W.G. Papst; am Morgen des 12. Februar bemerkt er schon am Weg in die Redaktion, in der er gerade erst seit sechs Wochen die Nachfolge von D. J. Bach angetreten hatte, anhand der massiven Polizeipräsenz, dass dieser Tag ein ganz anderer werden sollte, ohne zunächst zu wissen, dass der Aufstand in Linz bereits ausgebrochen war. Wie er die nächsten beiden Tage in Wien zubrachte, bevor er die Stadt, vermutlich über Bratislava Richtung Prag verließ, ist nicht bekannt. Jedenfalls traf er dort am 14 oder 15. 2. 1934 ein und konnte bereits auf ein Netzwerk von Exil-und Hilfsorganisationen zurückgreifen, das ein bescheidenes Auskommen und die nötigen Kontakte, u.a. zu entsprechenden Zeitungen, sicherstellen konnte. So gelingt es Rosenfeld, in Prag recht gut Fuß zu fassen; 1934 veröffentlicht er im Arbeiterjahrbuch eine Art Synopse seiner filmsoziologischen, film- und kapitalismuskritischen Überlegungen unter dem Titel Film und Proletariat. Versuch einer Soziologie des Kinos (Hausjell, 853), 1935 schreibt er bereits für verschiedene Zeitungen über Theater, Film und Kultur, so z.B. für das Zagreber Morgenblatt. Zeitungen wie der Sozialdemokrat oder Der Republikaner drucken neu entstandene Fortsetzungsromane ab: Die Brücke nach Ypsilon bzw. Das Kaffee in der Seitengasse (Mayr/Omasta, 38). Rosenfeld bespricht Aufführungen an den deutschsprachigen Bühnen, etwa des Neuen Deutschen Theaters oder des kleineren D 34, wo u.a. der Avantgarde-Regisseur Emil F. Burian inszeniert, wo Karel Čapeks R.U.R. wieder aufgeführt wird, aber auch Revuen mit Karl FarkasGeb. 28.10. 1893 in Wien, gest. 16.5.1971 in Wien. Der Sohn der ungarischstämmigen Eltern Moritz und Franziska Farkas, ... u.a.m. Darüber hinaus findet er in der tschechischen Niederlassung der Paramount-Filmgesellschaft Möglichkeiten zur Mitarbeit: als Lektor von Drehbüchern und Romanen für mögliche Verfilmungen, als Hilfskraft für Filmaufnahmen und Interviewer, ohne dabei seine kritischen Einstellungen aufzugeben:
Daß ich in Prag für eine amerikanische Filmgesellschaft arbeitete, verursachte mir keinerlei Gewissensbisse – ich hatte die kapitalistische Filmindustrie immer angeprangert, das wußte man in Hollywood, aber man bot mir doch einen Posten an, weil ich ja keinerlei Enstscheidungsmacht erhielt – ich war als Berater tätig. Ich las die neuen Romane und ging zu den Premieren der neuen Stücke und berichtete, was sich für Hollywood eignen würde und was nicht. Das meiste kam ja von Anfang an nicht in Frage. (Brief Rosenfelds 1987 an Hausjell; zit. Hausjell, 855)
Dabei freundete er sich mit dem Autor Karel J. Beneš an, dessen Roman Das geraubte Leben/The Stolen Life seinen Arbeitgebern, ohne Erfolg, empfahl. 1938 wurde der Stoff von der britischen Forum-Film unter der Regie von Paul Czinnergeb. am 30.5.1890 in Budapest - gest. am 22.6.1972 in London; (Drehbuch-)Autor, Filmregisseur, Kritiker Nach dem St... sowie mit Starbesetzung – Elisabeth Bergner und Michael Redgrave – doch verfilmt und kam im Jänner 1939, von Paramount zurückgekauft, in die Kinos und wird die Grundlage späterer Remakes bilden.
Nach der Okkupation der Tschechoslowakei im März 1939 wurde es auch für Rosenfeld eng. Seine Bemühungen um eine Ausreise hatten erst im August 1939 Erfolg, allerdings auch um den Preis der Vernichtung früherer Arbeiten und seiner Zeitungsausschnittsammlung. Auch die in Wien verbliebenen Familienmitglieder emigrieren 1939 über Italien nach Chile bzw. Ägypten (Mayr/Omasta, 42).
In London knapp vor Ausbruch des eigentlichen Krieges angetroffen, war Rosenfeld wie viele Exilanten auf Unterstützung angewiesen; er konnte aber bald Arbeit in verschiedenen Fabriken finden, die ihm körperlich zusetzte und seine schriftstellerischen Ambitionen entsprechend beeinträchtigte. 1940 erleidet Rosenfeld einen weiteren Rückschlag: die Internierung als ›friendly enemy alien‹ bis Dezember 1940 auf der Isle of Man, der anschließend jedoch die Rehabilitierung folgte, was v.a. die Aufhebung der Arbeitsbeschränkungen bedeutet. Rosenfeld, der wieder in kriegswichtigen Fabriken Arbeit findet, dankt 1942 mit einem Radiobeitrag für die BBC An Austrian Worker in an English Factory (Mayr/Omasta, 46f.).
Mit der Gründung der deutschsprachigen Zeitung im März 1941, an der bürgerlich-liberale sowie sozialdemokratische deutsche wie österreichische Journalisten und Förderer maßgeblich beteiligt waren (Hans Lothar, Sebastian Haffner, Hans Uhlig u.a.), und die vom Ministry of Information mitsubventioniert wurde, eröffneten sich auch für Rosenfeld wieder Möglichkeiten, journalistisch und literarisch tätig zu werden. Die Liste der österreichischen Beiträger liest sich wie ein Who is who des englischen Exils: Fritz Brügelgeb. am 13.2.1897 in Wien - gest. am 4.7.1955 in London; Schriftsteller, Bibliothekar, Historiker, Volksbildner Ps.: Du..., Erich Fried, Karl Federn, Theodor Kramergeb. am 1.1.1897 in Niederhollabrunn - gest. am 3.4.1958 in Wien; Lyriker Der Sohn eines aus Mähren stammenden jü..., Robert Neumanngeb. am 22.5.1897 in Wien – gest. am 3.1.1975 in München; Schriftsteller, Journalist, Kritiker, Exilant, Remigrant N..., Friedrich Porgesgeb. am 14.7.1890 in Wien - gest. am 24.1.1978 in Hollywood (USA); Schriftsteller, Drehbuchautor, Filmkritiker, Regisseu..., Hilde Spiel oder Hermynia Zur Mühlen (Mayr/Omasta, 48f.). Nebenher gelingt es ihm, einige Erzählungen in der Jüdischen Wochenschau in Buenos Aires, in der Neuen Volks-Zeitung in New York zu platzieren, mit der Arbeit an Hörspielen zu beginnen, die bald nach Kriegsende u.a. auch in der Schweiz, Holland, Belgien und Dänemark gesendet werden (Hausjell, 856).
Obwohl Rosenfeld von Oscar Pollak, führendem Mitglied der österreichischen (Exil)-Sozialdemokratie in London und späterem Chefredakteur der AZ im August 1944 auf eine Empfehlungsliste für „den Wiederaufbau der österreichischen Presse geeigneten Journalisten“ gesetzt wurde und seit Ende 1945 auch Beiträge (vorwiegend Filmkritiken) nach Wien schickte, zerschlug sich seine Rückkehr. In der neuen Redaktion wurde nämlich seine Mitwirkung torpediert und eine formelle Einladung erst 1948 ausgesprochen, – etwa zur gleichen Zeit, als Rosenfeld die britische Staatsbürgerschaft erhalten hatte und in der Redaktion durch Rückholung ehemaliger und Nachrücken neuer Mitarbeiter die meisten Positionen längst besetzt waren. Zwar hielt Rosenfeld nach dieser Brüskierung bis 1954 weiterhin Kontakt mit der AZ, um diesen dann – nach mehreren zurückgehaltenen Beiträgen – abzubrechen und sich fortan ganz auf seine britische Lebenswirklichkeit zu konzentrieren: als Mitarbeiter der Agentur Reuters ab 1946 – und in Wiederaufnahme seiner Arbeit an Kinder- und Jugendbüchern, nunmehr unter seinem Autornamen Friedrich Feld sowie in geradezu polemischer Distanz zu seinem Herkunftsraum Wien und Österreich.
Siglenverzeichnis
- AW: Arbeiterwille (Graz)
- BA: Bildungsarbeit
- GG: Goldene Galeere (F. Rosenfeld, 1931)
- NFP: Neue Freie Presse
- SW: Salzburger Wacht
- K: Der Kampf
- VP: Volkspost (Schwechat)
Abbildungen
Foto F. Rosenfeld, Mitgliedsausweis Austrian Press 1945 (London) © Nachlass, Verein der Geschichte der Arbeiterbewegung (Wien)
- Vgl. dazu das Standardwerk von Brigitte Mayr/Michael Omasta: Fritz Rosenfeld, Filmkritiker. Wien: Synema 2007, bes. S. 8f. (künftig zit. mit: Mayr/Omasta und der jeweiligen Seitenangabe). Ältere Einschätzungen zum Werk und zu Rosenfeld finden sich bei Ernst Glaser: Im Umfeld des AustromarxismusDer AM gilt vielfach zwar als nicht exakt umrissener Begriff, zugleich aber als anerkanntes und kennzeichnendes politisc.... Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des österreichischen Sozialismus. Wien u.a.: Europaverlag 1981, S. 496-501 sowie Fritz Hausjell: „Gedankt hat man es mir nicht.“ Anmerkungen zum Leben des exilierten österreichischen Sozialisten Fritz Rosenfeld und seinen Beiträgen zu Theorie und Kritik des Kinofilms. In: Fritz Stadler (Hg.): Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft 1930-1940. Bd.2 Münster: LIT 22004, S. 848-862. ↩
-
Dazu auch P.H. Kucher: Fritz Rosenfeld/Friedrich Feld – ein Fallbeispiel von Literatur- und Filmkritik, von Kulturprogrammatik und schriftstellerischer Praxis im Roten Wien. In: Rote Tränen. Die Zerstörung der Arbeiterkultur durch Faschismus und Nationalsozialismus. Hg. von Konstantin Kaiser, Jan Kreisky, Sabine Lichtenegger. = Zwischenwelt Bd. 14, Klagenfurt-Wien: Drava 2017, S. 83-100, bes. S. 85; künftig zit. mit Sigle Kucher, 2017. ↩ - Vgl. Jürgen Doll: Sozialdemokratisches Theater im Wien der Zwischenkriegszeit. Vom Sprechchorwerk zu den Roten-Spieler Szenen. In: P.H. Kucher (Hg.): Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde. Diskurskonstellationen zwischen Literatur, Theater, Kunst und Musik in Österreich 1918-1938. Göttingen: V&R unipress 2016, S. 79-94, S. 80f. ↩
- In derselben Nr. der SW besprach Rosenfeld auch den Hollywood-Roman Kuß – abblenden (orig.: Hollywood Girl, 1930) von J.P. McEvoy, den er ob seiner aufdringlichen Anpassungsstrategien als „blutige Satire“, als „eine einzige Verhöhnung der Filmstadt“ einstufte. Aus der weiblichen Hauptfigur entwickelte McEvoy Anfang der 1950er Jahre die Dixie Dugan-Figur, die in Seriencomics große Verbreitung fand. ↩
- Systematischer dazu: Mayr/Omasta, vgl. Anm. I. ↩
- Ausführlicher dazu May/Omasta, S.102-129 (avantgard. Kino) ↩
- Zur Kontextualisierung der (proletarischen) Kinder- und Jugendliteratur in die Debatten über den ›Neuen Menschen‹ vgl. Kerstin Gittinger: Proletarische Kinder- und Jugendliteratur. Eine Untersuchung zum Diskurs des ‚Neuen Menschen‘ in der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur der Ersten Republik. Wien, Dipl.Arb. unpubl. 2011; online zugänglich unter: http://othes.univie.ac.at/17308/1/2011-11-03_0601091.pdf Mit stärkerem Akzent auf das Exil vgl. Sonja Simone Savoy: Die Utopie des Märchenlandes. Wien: Diss. phil. 2014; online zuglänglich unter: http://othes.univie.ac.at/33614/ (Beide Arbeiten wurden von Ernst Seibert betreut). ↩
- Vgl. dazu meinen Beitrag: Radio-Literatur und Medienromane im Zeichen der Medienrevolution der 1920er Jahre. Die Radiowelt-Diskussion, A. Höllriegels Hollywood-Feuilletonroman und F. Rosenfelds Filmroman Die goldene Galeere. In: Julia Bertschik, P.-H. Kucher (Hgg.): „baustelle kultur“. Diskurslagen in der österreichischen Literatur 1918-1933/34. Bielefeld: Aisthesis 2011, S. 349-374. Künftig im Text zit. mit Sigle Kucher, 2011. ↩
- In: Die sozialistische Erziehung. Wien 1931, H. 12/1931, S. 282, zit. nach: Ernst Seibert: Figurationen von Gegenwelten in den frühen Kinderbüchern Friedrich Felds. In: Susanne Blumesberger, Jörg Thunecke (Hgg.): Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur während der Zwischenkriegszeit und im Exil. Schwerpunkt Österreich. Frankfurt/M.u.a.: P. Lang 2017, S. 141-159; im Fließtext zit. mit Sigle Seibert 2017. ↩