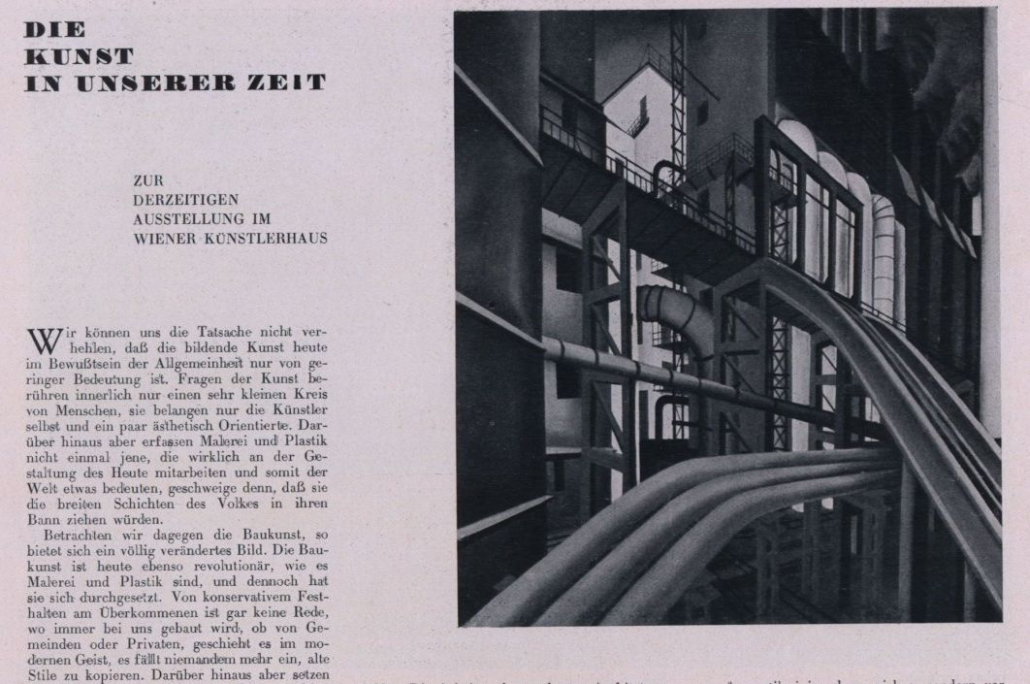1899 auf Initiative des Architekten Joseph Urban und des Malers Heinrich Lefler von Mitgliedern der sog. „Haagengesellschaft“ gegründet, war der Künstlerbund Hagen1899 auf Initiative des Architekten Joseph Urban und des Malers Heinrich Lefler von Mitgliedern der sog. „Haagengesell... – bald verkürzt als Hagenbund bezeichnet – neben dem Künstlerhaus und der Wiener Secession die dritte bedeutende Künstlervereinigung, die wesentlichen Einfluss auf das Wiener Kulturleben zwischen 1900 und 1938 nahm, darüber hinaus aber auch für die gesamte mitteleuropäische Kunstszene jener Zeit von großer Bedeutung werden sollte. Die Namensgebung geschah zu Ehren Josef Haagens, Besitzer des Gasthauses „Zum Blauen Freihaus“ in der Gumpendorfer Straße, das bereits ab 1881 als Treffpunkt für unregelmäßig stattfindende Künstlerzusammenkünfte gedient hatte. Im Jänner 1902 fand mit Unterstützung der Stadt Wien in der adaptierten Zedlitzhalle, einer ehemaligen städtischen Markthalle im 1. Wiener Bezirk, die erste Ausstellung des Hagenbundes statt.
Während die Wiener Secession die Avantgarde bildete und das Wiener Künstlerhaus einer konservative Ausrichtung verfolgte, vertrat der Hagenbund – zumindest in seinen Anfangsjahren bis etwa 1910 – einen eher gemäßigt-modernen Zugang und führte in der Folge durch seine offene Ausstellungspolitik verschiedene Stilrichtungen zwischen Expressionismus, Neuer Sachlichkeit und kubistischen Tendenzen zusammen. Schon 1907 organisierte der Hagenbund eine gemeinsame Schau ungarischer, polnischer, tschechischer und deutscher Künstler und beförderte auf diese Weise den Aufbau eines frühen Netzwerks europäischer Kunstschaffender in Wien. Für große Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch in Kunstkreisen sorgte die Kaiser-Huldigung-Ausstellung des Jahres 1908, die anlässlich des 60-jährigen Thronjubiläums Kaiser Franz Josephs in der Zedlitzgasse stattfand und in deren Rahmen die bisher größte Schau polnischer Kunst gezeigt werden konnte. Solche Initiativen waren umso bedeutsamer, als die österreichische Kunstszene zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend den Anschluss an die internationale Entwicklung verloren hatte; eine Tendenz, die sich mit dem Zusammenbruch der Monarchie und dem Tod von Klimt und Schiele (1918) noch verstärkte: „[W]ohl drückt uns heute die Absperrung von allem frischen Luftzug schwerer denn je, aber wir sind fest entschlossen, diese Verbindung wieder zu knüpfen. Der ganze starr gewordene Kunstbesitz dieser reichen armen Stadt muß von neuem Leben erfüllt werden.“ (Tietze, S. 123). In dieser Situation war es vor allem der Hagenbund, der mit Künstlern wie Ferdinand Ludwig Graf, Oskar Laske, Georg Mayer-Marton, Carry Hausereigentlich Carl Maria Hauser, geb. am 16.2.1895 in Wien – gest. am 28.10.1985 in Rekawinkel bei Wien; Maler, Grafiker,..., Felix Harta, Josef Dobner und Rudolf Stemolak wesentlich dazu beitrug, den Kontakt Österreichs zum internationalen Kunstgeschehen aufrechtzuerhalten bzw. zu forcieren. Jährlich wiederkehrende Frühlings- und Herbstausstellungen fanden Ergänzung durch Retrospektiven lokaler und internationaler Künstler, Gastauftritte befreundeter Künstlervereinigungen und Wanderausstellungen, wobei der Schwerpunkt der Kontakte neben Deutschland auf den ehemaligen Kronländern der Monarchie lag. Eine jahrelange, besonders enge Zusammenarbeit gab es mit der in Prag ansässigen Künstlergruppe Mánes. Die Finanzierung dieser kostspieligen Ausstellungspolitik erfolgte sowohl über Einnahmen aus Eintrittsgeldern als auch durch öffentliche und private Subventionen; die finanzielle Lage des Hagenbundes blieb aber sowohl vor als nach dem Ersten Weltkrieg durchwegs angespannt.
Neuartig war, dass im Sinne der Förderung eines Stilpluralismus weder den Mitgliedern noch von den Gästen eine bestimmte künstlerische Auffassung abverlangt wurde, womit sich der Hagenbund nicht als Stilrichtung, sondern vielmehr als eine Plattform der Information und des Austauschs etablierte. Zudem zeigte sich die liberale Grundhaltung der Künstlervereinigung auch in ihrer Bereitschaft, Frauen als außerordentliche bzw. korrespondierende Mitglieder aufzunehmen (wie z. B. Anna Lesznaigeb. am 3.1.1885 in Alsokörtvélyes, k.k. Österreich-Ungarn (heute Nizny Hrušov in der Ostslowakei) – gest. am 2.10..., Nora Purtscher-Wydenbruck und Bettina Ehrlich), was in den 1920er Jahren weder beim Künstlerhaus noch bei der Wiener Secession möglich war.
Die Wiener Kunstkritik fand teilweise wenig Gefallen an den vom Hagenbund organisierten Ausstellungen und stieß sich bevorzugt an den Werken der Österreichischen Moderne. So warf die Neue Freie Presse der Hagenbund-Schau des Jahres 1921 schlichtweg Unzulänglichkeit und Dilettantismus vor (NFP, 6.5.1921), während das Neue Wiener Journal die künstlerische Radikalisierung des Hagenbundes beklagte (NWJ, 9.5.1921). Noch vernichtender fiel die Kritik an der Frühjahrsausstellung des darauffolgenden Jahres aus: Das nationalkonservative Deutsche Volksblatt sprach von einem “verspäteten Faschingsscherz” und wies darauf hin, “daß normale Augen und ein normaler Geschmack an diesen Farbexzessen unmöglich Gefallen finden können.” (DVB, 25.4.1922). Gewogener argumentierten das Neue Wiener Tagblatt im Rückblick auf die Ausstellungen 1922, die Arbeiter-ZeitungGegr. 1889, verboten 1934, illegal 1934-1938, 1938 verboten, neugegr. 1945, eingestellt 1991 Aus: Arbeiter-Zeitung, 12...., etwa anläss. der Österr. Kunstausstellung im Rahmen des Internationalen Musik- und TheaterfestesWien, 14. September bis 10. Oktober 1924 Dieses groß angelegte Musik- und Theaterfest wurde nach einem ersten Vers... der Stadt Wien im Sept./Okt. 1924, wobei v.a. der “zu kubistisch-expressionistischer Form- und Farbgebung neigende […] Carry Hauser” neben Anton Faistauer und Anton Kolig herausgehoben wurde, aber auch Das Wort oder Die BühneGegründet 1924 durch den umstrittenen Zeitungsunternehmer Emmerich Bekessy, erschien die Zs. ab 6.11.1924 als Wochenzei.... Wolfgang Born bzw. Leopold W. Rochowanskigeb. am 3.8.1888 in Zuckmantel (Österr.-Ungarn; Zlaté Hory, Tschech. Rep.) – gest. am 13.9.1961 in Wien; Kritiker, S... berichteten in der Bühne jeweils über die Frühjahrsausstellung 1927 bzw. die Ausstellung im Rahmen der Festwochen 1928. 1928 beteiligte sich der Hagenbund auch führend an der Schiele-Gedächtnisausstellung sowie an der Sowjetrussischen Ausstellung, die 1930 eine Neuauflage erlebte. Das Wort zeigte sich begeistert über die Herbstausstellung 1927, an der neben C. Hauser und T. Gergely auch Radierungen von Picasso und Chagall gezeigt werden konnten. Seit Mitte der 1920er Jahre kam es dabei häufig zu Kooperationen mit der Neuen Galerie einerseits und zur Hereinnahme der Jahresausstellungen der Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs andererseits. Ab 1930 stellten auch die Photographen in den Räumlichkeiten des Hagenbunds aus, 1931 folgte eine große Schau zur europäischen Plastik, 1932 – auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise – kam erstmals das Tauschprinzip (Kunstwerk gegen Waren) als Möglichkeit des Erwerbs eines Werkes ins Gespräch.
Die wirtschaftlichen und politischen und Entwicklungen der 1930er Jahre führten bekanntlich dazu, dass zahlreiche Kunstschaffende Wien verließen bzw. verlassen mussten. Dennoch wurde der Ausstellungsbetrieb in eingeschränkter Form weiter fortgeführt. Auch die enge Zusammenarbeit vieler ehemals in Wien ansässiger Hagenbund-Mitglieder blieb über Landesgrenzen hinweg bestehen. Am 15. November 1938 wurde der Hagenbund auf Basis des Gesetzes über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden in die „Gemeinschaft bildender Künstler“ eingegliedert. Die Zedlitzhalle wurde in „Wiener Kunsthalle“ umbenannt und führte ihren Ausstellungsbetrieb bis 1944 fort.
Literatur
Agnes Husslein-Arco, Harald Krejci, Matthias Boeckl (Hg.), Hagenbund. Ein europäisches Netzwerk der Moderne 1900–1938, Wien 2014; Harald Krejci, Das Künstlernetzwerk Hagenbund. Innere Dynamik und äußere Einflüsse. In: Agnes Husslein-Arco, Harald Krejci, Matthias Boeckl (Hg.), Hagenbund. Ein europäisches Netzwerk der Moderne 1900–1938, 17-25; Markus Kristan, Joseph Urban. Die Wiener Jahre des Jugendstilsarchitekten und Illustrators, 1872–1911, Wien, Köln, Weimar 2000; Tobias Natter, Der Hagenbund. Zur Stellung einer Wiener Künstlervereinigung. In: Die verlorene Moderne: Der Künstlerbund Hagen 1900–1938. Ausstellungskatalog Österreichische Galerie Belvedere im Schloss Halbturn, Wien 1993, S. 9-27; Robert Waissenberger, Hagenbund 1900–1938. Geschichte der Wiener Künstlervereinigung, in: Mitteilungen der Österreichischen Galerie Belvedere, 16. Jg., 1972, S. 54–130; Hans Tietzegeb. am 1.1.1880 in Prag – gest. am 11.4.1954 in New York; Kunsthistoriker, Essayist, Redakteur, Ausstellungskurator, ..., Carl Moll zum 60. Geburtstag. In: Die bildenden Künste IV (1921), S. 123-125; Der Hagenbund. Ein europäisches Netzwerk der Moderne, 1900-1938; Peter Weinberger: Wie jüdisch war der Hagenbund? In: nu. Jüdisches Magazin für Politik und Kultur, 17.6.2015; online: hier.
Quellen und Dokumente
Hagenbund. In: AZ, 13.8.1920, S. 4; Frühjahrsausstellung Hagenbund. In: Neues Wiener Journal, 9.5.1921, S. 2; Frühjahrsausstellung Hagenbund. In: NFP, 6.5.1921, S. 15; 25 Jahre Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs. In: Die Österreicherin 8 (1936), S. 3; Die graphische Ausstellung des Hagenbundes. In: WZ, 19.1.1926, S. 5; Hans Ankwicz-Kleehovenbis 1901 Hans Klieres, geb. 29.9.1883 am Böheimkirchen (NÖ) - gest. am 1.10.1962 in Wien; Bibliothekar, Kunsthistorike..., Frühjahrsausstellung im Hagenbund. In: WZ, 27.6.1925, S. 1; Hagenbund. In: Reichspost, 6.7.1920, S. 1; Hagenbund. In: Neues Wiener Tagblatt, 26.10.1922, S. 24; Ausstellung der Prager Künstlergruppe „Manes“ im Hagenbund. In: AZ, 24.9.1923, S. 4; Hagenbund. In: WZ, 20.6.1926, S. 1; Sowjetrussische Ausstellung im Hagenbund. In: Rote Fahne, 8.3.1928, S. 3; Der Tanz in der bildenden Kunst. In: AZ, 6.2.1933, S. 3; Kokoschka-Ausstellung Hagenbund. In: AZ, 4.2.1911, S. 1f; Hagenbund. In: AZ, 23.11.1903, S. 1; Der Hagenbund. In: Prager Tagblatt, 27.2.1902, S. 1; Kurt Mühsam, Hagenbund. In: Sport & Salon, 30.1.1904, S. 13; Hagenbund. In: NFP, 6.4.1903, S. 1–3; Der Hagenbund – aufgelöst. In: AZ, 22.1.1901, S. 5.
(MK)